Romane & Erzählungen
Eine Geschichte f├╝r Sabrina
Kategorie Romane & Erzählungen
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
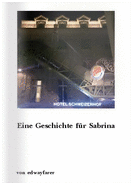
Eine Geschichte f├╝r Sabrina
Beschreibung
Eine schweizerische Stadtgeschichte. Autobiographisch und doch nicht. Schl├╝ssig und widerspr├╝chlich, lustig und traurig zugleich. Studenten, Handwerker und Hoffnungsvolle, sowie der Bodensatz der Gesellschaft. Hier treffen sie aufeinander.
Eine Geschichte.
“Melancholie hat ja auch etwas Romantisches. ┬ź…┬╗
Obwohl es uns so gut geht wie fast niemandem sonst, f├╝hlen wir uns schlecht. Das ist unsere Traurigkeit.”
Endo Anaconda, Interview im Tagesanzeiger vom 22.10.2009
Der Bedarf, eine Geschichte erz├Ąhlen zu wollen, muss gedeckt sein. Nur zu oft wird zum Besten gegeben, was euphorisch bewegt, doch sind es nicht auch die stillen oder ├Ąngstlichen Momente, welche mitgeteilt werden sollten, weil sie reflektieren, was ungestillt bleibt? Sind es nicht diese Augenblicke und Zust├Ąnde, die uns als Menschen alle gleich machen, uns auf Augenh├Âhe bringen und nur gemildert oder erstickt werden von der Erkenntnis, dass wir nicht alleine sind in unserer reflektierten Einsamkeit? Ist nicht dies das Bed├╝rfnis urexistenzieller Not?┬á
Kreislauf. Langeweile. Unruhe.
“Geist ist die Voraussetzung der Langeweile.”
Max Frisch, 1950: Tagebuch 1946-1949
Es regnete, die B├Ąume streiften bereits ihr buntes herbstliches Kleid ├╝ber und die Stra├čen waren bereits deutlich leerer als sie dies vor wenigen Wochen an einem Samstagmorgen um zehn noch gewesen w├Ąren. Ihr knielanger Mantel mit dem hochgeschlagenen Kragen und ihre hohen braunen Lederschuhe waren Tribut an die deutlich gesunkenen Temperaturen, ihr bunter Schal und die tief ├╝ber ihre Stirn gezogene M├╝tze Schutz vor der Mitwelt. An der Bushaltestelle wartete sonst niemand, Zigarettenstummel, zertrampelte Zeugen des freit├Ąglichen Nachtschw├Ąrmens, zerbeulte Feldschl├Âsschenb├╝chsen[1], Oasen abgestandener Ruhe nach einem allwochenendlichen Sturm. Sie hielt an: sie musste zur Arbeit.
Es war eines dieser alteingesessenen Lokale, versteckt in einer Seitengasse mitten in der Altstadt. Ein Lokal, welches sich in drei├čig Jahren kaum ver├Ąndert hatte, nur die ewig selben G├Ąste waren ├Ąlter geworden, grauer und dicker, langsamer und trauriger. Stammgast: wer kann sich denn noch daran erinnern in welchem Moment er seine endg├╝ltige Bindung zum Tisch in der Ecke eingegangen ist oder weshalb er in diesem schummrigen Biotop die freien Stunden seines Daseins fristet? Es sind Fragen, auf die kein Betroffener und kein Beobachter tiefgr├╝ndige Antworten wei├č. Hier also arbeitete sie als Serviertochter.
Das Licht im Lokal war sp├Ąrlich, die gr├╝nen Polster abgewetzt. Frischer Kaffeeduft belebte die ansonsten trostlose Atmosph├Ąre. Au├čer Atem - der Bus war nicht gekommen, sie hatte den weiten Weg laufen m├╝ssen - betrat sie das Restaurant. Der Wirt schielte auf seine Armbanduhr und hob eine bedeutungsvolle Braue. Sie traute sich nicht, ihn anzusehen und verschwand in der Personalgarderobe neben der K├╝che. Schnell Mantel, Schuhe, M├╝tze und Schal in eine Ecke geworfen, die Ballerinas ├╝ber ihre zierlichen F├╝├če gestreift, die blonden Haare, wei├če Bluse und den schwarzen Jupe glattgestrichen, ohne wirklich hinzuschauen einen Blick in den Spiegel ├╝ber dem kleinen Waschbecken geworfen; ungesch├╝tzt betrat sie die Gaststube. Die Fr├╝hschicht hatte mit Versp├Ątung begonnen.
Eine letzte Zigarette vor Einsatzende, im T├╝rrahmen des Hinterausganges hastig geraucht, den Qualm tief inhalierend und nur z├Âgerlich loslassend, es war f├╝nf Uhr. Um sechs hatte sie ihre Freiheit zur├╝ck, die letzten acht Stunden waren vergangen, sie h├Ątte sie nicht in zusammenh├Ąngenden S├Ątzen zusammenfassen k├Ânnen, zu monoton war ihr Arbeitsalltag, zu gedankenlos die Abl├Ąufe. Nun aber war alles zur├╝ck, die Leute in den engen Gassen, die grellen Schaufensterbeleuchtungen, Werbeplakate, grauen Kaugummih├Âcker auf den Trottoirs und die Gedankenwelt, diese treue und manchmal l├Ąstige Begleiterin.
[1] ‚Feldschl├Âsschen’: bekannte CH Biermarke
Ablenkung. Einsamkeit. Auftakt.
"Was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also die einzige T├Ątigkeit, auf die sie sich noch versteht. Was k├Ânnte verh├Ąngnisvoller sein?"
Hanna Arendt, 1960 (1958): Vita activa oder vom t├Ątigen Leben
Die beste Freundin hatte angerufen, sie wollte ausgehen, zwei weitere M├Ądchen waren auch mit von der Partie, die Samstagnacht sollte die sechs Abende davor vergessen machen. Diesmal kam der Bus, er war ├╝berf├╝llt, die ganze Stadt str├Âmte ins Zentrum, alles verschmolz. Sie hatten sich in einer Bar verabredet, hier konnte man sich bestens auf den Abend einstimmen, die Getr├Ąnke waren billig, man durfte drinnen rauchen, es flatterten haufenweise Nachtschw├Ąrmer um die Theke, die Stimmung war gut. Heute w├╝rde eine gute Nacht werden, sagten ihre drei Begleiterinnen.
├ächzend stand er auf, hatte beinahe den ganzen Tag im Lokal bei Bier, Nussgipfel und Zeitung verbracht. Es war Zeit, nach Hause zu gehen. Die Stadt war voll von Hastenden, gehetzt wie die nette Serviertochter, Laura, im ‘Resti’[1] heute Morgen auch. Zu ihm war sie aber freundlich wie immer gewesen: ‘No e Stange, K├Âbi?’[2] – zuverl├Ąssig im Halbstundentakt; Jakob schmunzelte zufrieden, soviel Aufmerksamkeit erhielt er nur von ihr. Seine Frau war bestimmt schon daheim und sa├č bei der mittern├Ąchtlichen Tagesschau; seine Schritte beschleunigten sich widerwillig. Der Bus wartete sicher schon, er w├╝rde nicht in der K├Ąlte warten m├╝ssen. Wieso Laura heute Morgen wohl zu sp├Ąt im Restaurant gewesen war?
Lachend verlie├č sie mit ihren drei Begleiterinnen die Bar, sie hatten etwas getrunken und sich gut unterhalten: ├╝ber Ferientr├Ąume, Arbeitskolleginnen und nat├╝rlich Jungs, man hatte fast kein Thema ausgelassen; doch nun war es h├Âchste Zeit f├╝r ein Lokal, in welchem man sich nicht mehr unbedingt┬áunterhalten musste und daf├╝r tanzen konnte. Sie eilten das Trottoir entlang ins Menschenget├╝mmel hinein, die Menge verschluckte sie.
[1] CH Dialekt f├╝r ‚Restaurant’
[2] CH Dialekt f├╝r ‚Noch ein kleines Bier, Jakob?’
Angst. Best├Ątigung. Sorglosigkeit.
“We fear violence less than our own feelings. Personal, private, solitary pain is more terrifying than what anyone else can inflict.”
Jim Morrison
Im Quartier war es schon ganz still, als K├Âbi aus dem Bus stieg. Er fuhr zusammen: Druckluft entfloh laut zischend dem Fahrzeug, welches ihn eben in die N├Ąhe seines Heimes gebracht hatte; der Asphalt gl├Ąnzte, es hatte hier wohl kurz zuvor noch geregnet. Er schlurfte gem├Ąchlich Richtung Hochhaus├╝berbauung West: er hatte keine Eile.
Keuchend schleppte sich K├Âbi in den Hauseingang seines Wohnsilos und fummelte in seiner Manteltasche nach dem Schl├╝ssel, gleichzeitig bet├Ątigte er die Klingeltaste seiner Wohnung. War Jeanette denn eingeschlafen oder ausgegangen? Seine Gedanken ├╝berschlugen sich, etwas flog neben seinem Kopf vorbei und klirrte gegen die Wand.
Marco war au├čer sich vor Freude, er hatte eben den Anruf erhalten, auf den er seit Wochen gewartet hatte. Seine neue Stelle versprach eine tolle Herausforderung zu werden, er w├╝rde sich beweisen k├Ânnen und er hatte sich vorgenommen, seinem neuen Arbeitgeber, dem gr├Â├čten Baugesch├Ąft der Region, gleich von Anbeginn zu zeigen dass dieser sich f├╝r den richtigen Kandidaten entschieden hatte. Er stieg aus der Dusche, machte sich fertig um auszugehen; seine Kumpels warteten schon in der Stadt, die Anstellung, sie musste t├╝chtig begossen werden! Marco pfiff leise als er die T├╝r hinter sich verschloss und eilte die Treppe hinunter, er hatte bereits etwas Versp├Ątung.
Lautes Gejohle begr├╝├čte Marco im Lokal, seine Freunde dr├Ąngten sich um zwei runde, kleine Stehtische, die Aschenbecher quollen ├╝ber, leere Biergl├Ąser dr├Ąngten sich dicht auf den Tischchen, denn er war ├╝ber eine Stunde zu sp├Ąt erschienen.┬á‚Geile Siech, gratuliere dr, Aute!’[1] – seine Kumpels begr├╝├čten ihn ├╝berschw├Ąnglich, alle freuten sich f├╝r seine Bef├Ârderung; die Stimmung war euphorisch und bereits auf einem H├Âhepunkt. Hier, in dieser Bar, konnte man sich bestens auf den bevorstehenden Abend einstimmen, die Getr├Ąnke waren billig, man durfte drinnen rauchen, es flatterten haufenweise Nachtschw├Ąrmer um die Theke, die Stimmung war gut. Heute w├╝rde eine gute Nacht werden, sagten Marcos Begleiter.
Wie ein Igel rollte K├Âbi seinen unf├Ârmigen K├Ârper im Hauseingang zusammen, er hatte es nicht geschafft, die T├╝re aufzuschlie├čen, wo wohl Jeanette war? Er schloss die Augen und h├Ârte im selbst erzeugten Dunkeln schwere, rasche Schritte auf ihn zukommen, einer lallte: ‚Br├Ątsch d├Ą Siech, Pesche, schutt im i’d Eier, JAWOHL!’[2] – K├Âbi wurde schlecht, er musste sich beinahe ├╝bergeben, so ein Tritt in den Unterleib: die Libido l├Ąngst inexistent, doch der Schmerz noch stets derselbe, wie vor Jahren auf dem Schulhof, als Fritz B├Âgli jeweils in der grossen Pause die Schl├Ąge seines Vaters an den Klassentrottel, K├Âbi, weitergab.
[1] CH Dialekt f├╝r ‚Toll gemacht, Mensch, herzliche Gratulation!’
[2] CH Dialekt f├╝r ‚Schlag in Peter, kick’ ihn in die Hoden, Jawohl!’
Kommentare
Kommentar schreiben
| edwayfarer Re: F├╝r S. - Vielen vielen Dank f├╝r das Lob, der Text ist eine Erz├Ąhlung f├╝r meine Freundin, an der ich ettappenweise schreibe. Die Wiederholung ist gewollt ;-) LG, E. Zitat: (Original von Zeitenwind am 19.03.2013 - 16:19 Uhr) Ist die Wiederholung im Text gewollt? Wenn ja w├╝rde ich das noch besser finden, als ich dieses St├╝ck ohnehin ist. Kein Detail ausgelassen, gut beschrieben. Die Melancholie wird deutlich hervorgehoben, man lebt sie mit. Alles in allem hat mir Dein Text sehr gut gefallen. Gru├č vom Trollb├Ąr |
| Zeitenwind F├╝r S. - Ist die Wiederholung im Text gewollt? Wenn ja w├╝rde ich das noch besser finden, als ich dieses St├╝ck ohnehin ist. Kein Detail ausgelassen, gut beschrieben. Die Melancholie wird deutlich hervorgehoben, man lebt sie mit. Alles in allem hat mir Dein Text sehr gut gefallen. Gru├č vom Trollb├Ąr |