Romane & Erzählungen
JahresZeiten - zwischen den Welten
Kategorie Romane & Erzählungen
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
Vadim Palmov z√§hlt zu den renommierten Pianisten Russlands. Er studierte bei Nathan Perelman in St. Petersburg und ist seither durch Auftritte im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion als auch im westlichen Ausland bekannt geworden. Als Solist konzertierte er mit f√ľhrenden Sinfonieorchestern Russlands. Seine k√ľnstlerischen Interessen gehen von Bach bis Beethoven, von Chopin bis hin zur Klaviermusik des 20. Jahrhunderts. Unter allen Gattungen des ...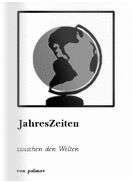
JahresZeiten - zwischen den Welten
Beschreibung
Der Mensch wird gepr√§gt durch die Epoche in der er lebt, durch die Menschen die ihm begegnen und durch die Orte, an die es ihn verschl√§gt. Die Verkn√ľpfung dieser Elemente und ihr Einfluss auf das menschliche Schicksal zeigt sich immer erst in der Zukunft. In filigraner Sprache gelingt es dem Autor, die F√§den anhand seines eigenen Schicksals dem Leser n√§her zu bringen. Russische Sprache und Literatur des bekannten Petersburger Pianisten in ihrer besten Tradition
Selbstgespräch
Das Schicksal nimmt seine Wendungen viel früher als das eigentliche Geschehen, das wir als schicksalhaft begreifen.
Undeutliche innere Unruhe treibt uns, aber wir hören nicht das Uhrwerk, das Jahre, Monate, Tage und manchmal Minuten zählt bis …
Bis wohin?
Ich horche in mich hinein.
Ich versuche neue Wendungen zu erraten.
Der Flug von Sankt Petersburg nach Hannover, der von der Pulkowsker Startbahn abhob, brachte uns drei fort - gemeinsam mit Wolgadeutschen aus Kasachstan - Männern mit Lederjacken und Mützen, Frauen mit Kopftüchern und synthetischen Kleidern. Zum ersten Mal saßen wir in der gleichen Kutsche. Sie und wir waren Aussiedler.
Es war früher Morgen. Der Körper wehrte sich und tat weh. Die Seele fühlte sich trostlos an. Ich wollte trinken... erinnerte mich an den Umzug nach Leningrad aus Swerdlowsk, der Stadt meiner ersten achtzehn Lebensjahre.
Auch eine meiner Schicksalswendungen.
Der Flug wurde damals mehrfach verschoben, und jedes Mal nahm ich schweren Herzens Abschied von meiner Mutter. Wir fuhren gemeinsam zum Flughafen und … kehrten wieder nach Hause zurück.
Dann später Abflug nach Leningrad, der Stadt, die mich früher wie ein Magnet angezogen hat und die mir mit ihren leeren kalten Straßen in dieser dunklen Augustnacht so fremd erschien.
Noch viele Jahre nach meinem Umzug nach Sankt Petersburg (nachfolgend: „Petersburg“) konnte ich mich nicht von meiner Mutter losreißen. Für lange Zeit war die Landung in Swerdlowsk ein Moment des Glücks für mich. Der Abschied indes fiel schwer.
Vor vielen Jahren lockte mich, ein angereistes Schulkind im Sommerurlaub, Leningrad fröhlich mit den glänzenden Kuppeln und Turmspitzen, mit dem Geruch von Wasser, mit sanftem Sommerwind...
Meine einsame große Stadt, in der es, wie ein weiser Mann einst sagte, keine Geborgenheit gibt… So liebe ich sie noch nach Jahren...
Diese Liebe wird im Unterschied zur ersten Verliebtheit bis ins Grab reichen.
So lockte auch Deutschland mit Sonne, blühenden Magnolien, rheinischen Burgen, lautlosen Fahrzeugen, mit allgemeiner Höflichkeit, die als ehrliche Empfindung verstanden wurde, und mit Sauberkeit – nicht der schlechteste Umstand für einen, der die Nase voll hatte von schlechten Gerüchen in der Heimat.
All dies wurde auch durch die Herzlichkeit von Freunden erwärmt, die mich empfingen und alles für mein Wohlbefinden taten.
Für mich ist Deutschland bis heute so: sonnig, höflich, appetitlich.
Und Freunde, die schon dreißig Jahre hier leben, sind mir wie damals treu und in Liebe verbunden.
Das Flugzeug flog pünktlich Richtung Hannover. Männer mit Mützen sowie Frauen mit Kopftüchern und Kindern an den Händen stellten sich in die Schlange vor die Toiletten.
Nach alter sowjetischer Manier waren wir drei elegant angezogen – wir flogen ins Ausland! Ich erinnere mich an mein weißes Sommerjackett, vor kurzem während eines Gastspiels in eben jenem Deutschland gekauft. In ihm stand ich einige Zeit später im Lager für Aussiedler vor dessen Leiterin, einer Frau N., mit DDR- und Parteivergangenheit.
Aber im Flugzeug war dies noch nicht aktuell.
Ich trank einen Gin.
Auftakt
Dem Klang des Orchesters geht der Auftakt voraus. Es ist eine Geste des Dirigenten, die den Musikern den Charakter der Bewegung der Musik vermittelt und in der Literatur ungefähr so beschrieben wird: Der Dirigent hebt den Taktstock und es fließt die Melodie!
Der Auftakt zu Beginn meines „bewussten“ Lebens war der Tod meines Vaters. Ohne Frage war das mein erstes richtig bewusstes und tief ins Herz gehendes Erlebnis. Die schlanke Konstruktion meiner damals siebenjährigen Existenz geriet ziemlich in Schieflage.Das Leben begann mit seinen schicksalhaften Wendungen.
Vater war mein Held. Er war mein Held im Leben, daran kann ich mich gut erinnern. Nach seinem Tod wurde er zur Legende. Er wurde von vielen geliebt... und wie hätte man ihn nicht lieben können? Sein Temperament „schleuderte“ ihn in die unterschiedlichsten Bereiche: Vater war wie ich Pianist mit Hochschulausbildung, was ihn offensichtlich einengte. Er verfasste Lieder und Gedichte √ʬĬē beides wurde von Zeit zu Zeit publiziert. Mit neunundzwanzig Jahren entschied er sich für die Regie, trat in das Leningrader Theaterinstitut ein, in einen Kurs von Towstonogow! 1 Die Kommilitonen schätzten ihn als hervorragenden Schauspieler.
Er war lange krank und starb qualvoll. Jetzt erst verstehe ich, dass die Wendungen meines Schicksals schon lange in seinem Körper herumwanderten und dass sein Tod unser Leben abrupt veränderte. Nach einigen Jahren kam ein „anderer Mann“ in unser Haus und alles brach zusammen.
Vater gibt es schon seit fast 40 Jahren nicht mehr, aber seine Signale kommen bis heute an: dort Publikationen von Gedichten, da, unbekannt woher, eine Rundfunkaufnahme seiner Lieder, und Geschichten über ihn von mir bisher unbekannten Menschen...
In den 90er Jahren, bei einem Gastspiel in Woronisch, kam nach dem Konzert eine Frau in meine Künstlergarderobe, die mein Vater mit neunzehn Jahren geheiratet hatte. Ihre Ehe hielt nicht lange.
Schon früher, 1989 in Leningrad, fand ich meinen Halbbruder, der unehelich geboren wurde. Erst dann, im Alter von siebenundzwanzig Jahren, habe ich erfahren, dass Vater nicht nur einen Sohn hatte.
Er mochte Überraschungen.
Der letzte, erst vor kurzem erfolgte Gruß, ist ein Film, in dem Lieder nach den Gedichten meines Vaters erklingen …
Ich vermute, das wird nicht seine letzte Botschaft sein …
----
Das Lager für die in Deutschland aus der ehemaligen UdSSR neu Angekommenen lag in einem kleinen eleganten Städtchen nahe Hannover. Dorthin fuhren wir vom Flughafen mit dem Taxi für 200 Mark. Unser „effektvolles“ Erscheinen bei den vorher eingetroffenen Landsleuten, Männer mit ausgebeulten Trainingshosen und Frauen mit synthetischen Blusen, sah mehr als absurd aus.
Ich erinnerte mich an Mutters Spruch „Kultur ist Angemessenheit!“…Wirklich, das Ausspucken im Museum ist genauso unangemessen wie das Wort „Agnostik“ aus dem Mund eines hochverehrten Wissenschaftlers im Gespräch mit Bergarbeitern in Kusbass.
Alles an seinem Platz. Du hast Recht, Mama: Kultur ist Angemessenheit. Wie oft in meinem Leben konnte ich mich davon überzeugen. Wie unangemessen sahen wir doch in unserer Kleidung aus, als wir uns aufstellten, um die bürokratisch zugeteilten Teller und die Bettwäsche zu empfangen! Wie komisch wirkten wir damals, als wir im Keller mit den vergitterten Fenstern auf unseren doppelstöckigen Etagenbetten saßen.
Wie war das alles eigenartig für uns, die gewohnt waren als gastierende Künstler aus Petersburg nach Deutschland zu kommen…
Julia arbeitete in Petersburg am „Maly Operntheater“, das jedes Jahr einen Monat in Heilbronn gastierte.
Sogar dem kleinen Igor gelang es, mit einer Gruppe junger Musiker einige Konzerte in Deutschland zu geben.
Es ist schon wahr, Emigration ist das beste Mittel gegen Arroganz. (Ich weiß nicht mehr, bei wem ich das gelesen habe...).
Es lag nicht an unserer Kleidung - unser Selbstbewusstsein war nicht angebracht!
Das Leben zeigte uns eine lange Nase.
Die Wände der Unterkunft waren mit Inschriften in russischer Sprache übersät, mit Verboten und Drohungen (Beispiel: Die Toiletten werden geschlossen, wenn ihr Dreck macht!).
In der Kantine bei der Essenausgabe hob eine stämmige Frau mit der Gabel ein so dünnes durchsichtiges Stück Wurst auf, dass es zerriss, bevor es auf dem Teller landete. Die Chance, morgens einen Kaffee zu ergattern, war nicht groß, weil erfahrenere Landsleute, flink um den Mangel der Waren wissend, witterten, wann und wo „das Begehrte“ auftauchen würde… Fast immer war Punkt 8.00 Uhr morgens die Kanne mit Kaffee bis zum letzten Tropfen leer.
Eine unglaubliche Tatsache, aber kaum einer meiner Mitbürger, die solche Übergangslager erlebten, erzählte in der Heimat über die „Güsse kalten Wassers“, die im Nu die Selbsteinschätzung in Frage stellen können.
Die nicht beneidenswerte Lage, sich in einer fremden Sprache ausdrücken zu müssen, räumt den gut Sprechenden einen psychologischen Vorteil ein und degradiert die Stammelnden und Stotternden. Das „ausländische“ Fernsehen artikuliert ein einziges endloses Wort, weil Sie nicht in der Lage sind, nach Gehör Wort von Wort zu unterscheiden. Die Furcht, eine Straßenbahn zu benutzen, sorgt für lange Spaziergänge und abgelaufene Schuhe. Sie stürzten aus dem Laden oder gehen erst gar nicht hinein, aus Angst vor der herannahenden lächelnden Verkäuferin, die ihre Hilfe anbieten will. Sie selbst sind stumm. Jeder kleine Bürokrat behandelt Sie so verächtlich, als ob Sie erst gestern von einem Baum heruntergekommen und den Schwanz noch nicht losgeworden wären. Sie sind kein Einheimischer, Sie sind ein „Sowjets“.
Ich erinnere mich, auf der Straße dieses ersten Städtchens in unserem deutschen Leben kam ein Frauenkopf aus einem haltenden Auto heraus, fragte uns nach dem Straßennamen und wie man dorthin fahren müsse. Am ersten Tag unseres Aufenthaltes konnten wir ihr keine vernünftige Antwort geben, trotzdem atmete ich tief ein und presste aus voller Brust eine auswendig gelernte Phrase heraus „Wir sind fremd hier...“ und bekam augenblicklich die Antwort „Ja, ihr seid wirklich fremd hier!“.
Es dunkelte, ich schleppte mich zum Schlafengehen in ein fremdes doppelstöckiges Bett in einem Keller mit vergittertem Fenster und schwamm und schwebte in Erinnerungen…
Wie süß ist die Vergangenheit! Wie gut, wie gemütlich ist es in ihr zu leben, wie menschlich! Die Vergangenheit war besser als das Heute, ich weiß es genau. In der Vergangenheit war es unmöglich, Ältere zu beleidigen und ihnen keinen Sitzplatz im Bus anzubieten. Selbst Schlägereien gingen damals nur bis zum ersten Blutstropfen. Vergangenheit ist Gegenwart. In ihr seid Ihr, meine Lieben, meine Weggegangenen, die, weiß Gott wozu, zum anderen Ufer weggeschwommen sind. Ich sehe es, dieses Ufer, ich weiß - Ihr lebt dort, liebend, trauernd, wie einst hier. Und genau wie einst hier, pünktlich um 9.00 Uhr morgens, setzt sich mein teurer Lehrer Nathan Efimowitsch Perelman an den Flügel und beginnt den Tag mit Mozart: „Ich beginne den Tag mit Mozart, wenn es noch dunkel ist, was für eine Wonne!“. Dort seid auch Ihr, Busja2 und Kotja (Vaters Eltern rief ich – Busja von Babusja2 und Kotja-Opa hieß Konstantin). Dort sind Oma und Opa, die Eltern meiner Mutter.
Dort ist Vater.
Ihr seid so nah.
„Die Vergangenheit vermissen wir, die Gegenwart schätzen wir nicht, nach der
Zukunft streben wir.“ (Opa)
Zwei durch Vaterlosigkeit seelisch verletzte Jungs, ich und mein Cousin, der Sohn der Schwester meiner Mutter, wuchsen zusammen auf. Meinen Vater gab es nicht mehr und sein Vater hat ihn einfach vergessen. Ich weiß nicht warum, aber wir saßen auf dem Schrank, der im Schlafzimmer meiner Großmutter und meines Opas stand, im warmen vertrauten Großelternhaus in der Popowstraße in Swerdlowsk und schrieben ein Buch.
Die Helden des Buches waren von uns gespielte, absolut monströse Personen – Glawar, der Anführer des Erdballs, sein Zwillingsbruder, der stärkste Mann der Welt, und der Sohn von Glawar. Alle drei lebten unzählige Jahre und quälten das Volk. Als Zeitrechnung dafür erfanden wir eine neue mathematische Einheit „Siksiliard“. Der Bruder von Glawar entfernte aus der Mitte der Erde den Erdkern. An seiner Stelle entstanden Länder mit Völkern, die eine Kopeke Jahresgehalt erhielten und die für kleinste Vergehen erschossen wurden. Über Vergeltung an den Tyrannen schwieg die Geschichte.
Das Buch wurde mit der Hand geschrieben - im Haushaltsfoliant, den wir Opa gestohlen hatten.
Nachdem uns unsere literarische Kunst langweilig wurde, sprangen wir vom Schrank auf die dort stehenden Betten herunter. Nach einem solchen Sprung brach eines davon unter dem an Größe und Gewicht zugenommenen Körper meines Cousins zusammen.
Opa, ein Gegner der didaktischen Erziehung, unterließ nicht nur das Schimpfen, sondern brachte uns Essen zum Schrank, damit unser literarischer Prozess nicht unterbrochen werden musste.
Wie wohl fühlten wir uns trotz 40 Grad (!) Frost. Wenn im Radio offiziell die Schüler vom Unterricht befreit wurden, saßen wir auf dem Schrank in der warmen Wohnung mit von Eisblumen blinden Fenstern und schrieben unser Buch. Im Haus von Oma und Opa gab es eine ganze Reihe der von uns verursachten Beschädigungen, darunter auch größere als das zerbrochene Bett.
Unser Wunsch, zu zerstören, war nicht zu bremsen: Das Resultat war in seinen gigantischen Ausmaßen überzeugend.
Es ist heute schwer, dieses kindliche Verlangen, etwas zu beschädigen, zu verstehen - einen heftigen unüberwindlichen fast tierischen Instinkt.
Warum habe ich das gemacht?
Warum? (Pyromanie)
Es war ein Streichholz, ein brennendes Streichholz, nahe beim Tüllvorhang im Schlafzimmer von Oma und Opa, das Gefühl einer noch nicht erfolgten Katastrophe, aber ihre Nähe...!, fieberhaft aufgeregt..., höchste Spannung..., die Fantasie war nicht mehr zu stillen, ohne sie in die Tat umzusetzen und das Schreckliche zu tun.
Die Gardine loderte sofort. Gemeinsam mit ihr brannten der Kleiderschrank und der Fensterrahmen. Der brennende Kronleuchter veränderte seine Form, die Decke schwärzte sich. Nicht in der Lage, das Feuer zu löschen, rannte ich in das Arbeitszimmer meines Großvaters, wo er wie üblich etwas las. „Feuer!“, schrie ich, als ob ein anderer und nicht ich der Brandstifter gewesen wäre. Hinter Opa rannte Oma ins heiße Schlafzimmer. „Meine Unterhose!“, schrie der Großvater, in der Hoffnung, die zum Trocknen auf die Heizung gelegte Unterwäsche zu retten. „Ach was, deine Unterhose! Sie kostet 20 Kopeken, dort ist mein Kleid!“, rief Oma, die versuchte, gemeinsam mit Opa die Flammen zu löschen. Gott sei Dank gelang es ihnen.
Ich rannte ins Arbeitszimmer und saß dort lange alleine, erschüttert von dem, was ich getan hatte.
Anschließend schrieb ich auf ein Blatt aus einem Heft: Ich schwöre bei der Gesundheit meiner Mutter, dass sich das niemals wiederholen wird.
Opa las es.
Weder er noch Oma schimpften mit mir.
-----
Am Morgen des zweiten Tages in Deutschland wurden wir in das Büro der Lagerleiterin Frau N. gebeten. Mit unserer Eleganz und der betont offenen Freundlichkeit versuchten wir den Eindruck zu erwecken, europäischer zu sein als unsere Landsleute.
Ja, ja, es war so...,was sollte man hier auch verstecken.
Vom Gespräch mit Frau N. blieb nur dieser Teil haften: Auf meine Frage, ob es nicht möglich sei, irgendwo in diesem kleinen Städtchen einen Flügel zum Üben aufzutreiben, bekam ich die prompte Antwort: „Hören Sie auf, sich Illusionen zu machen! Wenn Sie denken, Sie könnten Ihren Beruf hier weiterhin ausüben, dann irren Sie sich gewaltig. Die Lage am Arbeitsmarkt...“
Und so weiter im gleichen Stil...
Ich stand wie gelähmt vor ihr.
An diesem zweiten Tag, auch in den nächsten Monaten und sogar nach Jahren, waren wir praktisch wie Kinder, die nicht antworten können. Im Alltag dieses neuen Lebens lernten wir nur langsam, was man darf und was man nicht darf. Die raue sowjetische Vergangenheit hat uns gelehrt, immer dann zu schweigen, wenn wir gedemütigt wurden.
Doch unsere Fähigkeit, über jede beliebige Situation zu lachen, rettete uns vor der Mutlosigkeit.
Frau N. zierte sich unsertwegen nicht. Schon am nächsten Tag wurden wir zwecks „Heilung unseres Hochmuts“ in ein weit entferntes Lager - drei Stunden Fahrt von Hannover - verlegt, weggeschickt von dem Ort, der uns so anzog und der in nur 30 Minuten Fahrzeit mit der Regionalbahn zu erreichen war.
Später erfuhren wir von Emigranten, dass die so strenge Frau N. nicht alle gleich behandelt hat:
Es hing von gewissen Umständen ab.
*
Ich denke es war 1971. Es vergingen zwei Jahre nach Vaters Tod. Opa, um einen gesunden Urlaub für seine Enkel besorgt, mietete eine Datscha am See Schartasch bei Swerdlowsk. Alles war fertig zur Abreise.
Im Hof der Popowstraße, wo Oma und Opa lebten, spielten Jungs in dieser Zeit traditionell Hockey und Fußball miteinander und warfen Taschenmesser. An sonnigen Tagen brannten sie mit einer Lupe die hölzerne Sitzbank an. Mein Cousin spielte mehr mit ihnen als ich, der diese Hofgesellschaft nicht mochte.
Unter den Nachbarskindern waren zwei, die im vierten Stock des gleichen Hauses mit unseren Großeltern wohnten. Ich weiß nicht mehr, wie und wann diese Jungs einen kleinen Straßenhund namens Tschernisch beherbergten, der eine Zeitlang bei ihnen in der Wohnung lebte und dann verschwand. Ob er weglief oder ob man ihn wegbrachte, weiß ich nicht. Doch vor unserer Abreise mit Großvater an den Schartaschsee, erschien Tschernisch plötzlich in unserem Hof. Er sah arg mitgenommen aus, seine Augen verrieten sein bitteres Leben außerhalb des Hauses.
Seine Besitzer waren nicht zu finden. Es war Sommer, alle fuhren aufs Land. Mein Cousin und ich dachten nicht lange nach und nahmen den Hund mit.
Oma lebte in dieser Zeit von ihrer Rente als Gynäkologin. Als eine unglaublich auf Sauberkeit bedachte Frau konnte sie sich über die Anwesenheit eines umherstreunenden Hundes im Haus nicht freuen. Opa ließ auch keinen Enthusiasmus erkennen. Trotzdem erlaubten sich beide kein Anzeichen des Widerstandes gegenüber dem humanen Verhalten ihrer Enkel, die einem wehrlosen heimatlosen Geschöpf Obdach gewährten.
An den Schartasch fuhren wir gemeinsam mit Tschernisch.
Warum? (Urin-Fäkal-Erzählung)
Großvater mietete für uns ein Zimmer in einem kleinen Holzhaus. Die Wirtin des Hauses war eine einfache russische Frau, die keine besonderen Erinnerungen bei mir hinterließ. Sie ließ uns zu dritt bei ihr in einem großen Zimmer wohnen und befahl uns, das sehr kleine zweite Zimmer mit einem Bett, dörflich zugedeckt mit einem Bettüberwurf aus Tüll und Kissen, nicht zu betreten.
In unserem großen Zimmer war viel unterschiedliches Zeug. Wir schliefen in den dort stehenden Betten und brachten Klappbetten mit. Es gab auch was zur Unterhaltung: Zwischen anderen alten Möbeln stand ein Radioplattenspieler sowjetischer Herkunft namens „Radiola“ – eine Kombination zwischen Radio und Monoplattenspieler.
Es versteht sich von selbst, da es an anderen Unterhaltungen mangelte - rund um uns war nur das Dorf und der See, Opa saß wie immer in der Dorfbibliothek - lenkten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Radiola.
Zu unserem Vergnügen fanden wir auch Schallplatten. Leider nicht richtigen! Es gab zur damaligen Zeit, die mit dem Wort „Stagnation“ gebrandmarkt wurde, die populäre Zeitschrift „Krugossor“, die, wie ich glaube, einmal pro Monat erschien. In der Zeitschrift wurden Informationen über populäre Musik publiziert, hauptsächlich sowjetische. Jedoch am meisten begehrt waren die biegsamen Schallplatten, die der Zeitschrift beilagen. Manchmal konnte man auf diesen Schallplatten - „Speck für Mäuse“, damit die Zeitschrift überhaupt abonniert wurde - etwas von der erlaubten und verlockenden ausländischen Popszene finden.
Ausländische Interpreten in der Sammlung unserer Hauswirtin fanden wir nicht. Es blieb uns nichts anderes übrig, als uns mit dem populären Hit der 70er Jahre, „Geschwätz, Geschwätz …“ zu begnügen, gesungen von einer unbekannten pseudofolkloristischen Sängerin.
Ich kann mich nur noch an den Refrain erinnern:
Geschwätz, Geschwätz,
Worte ziehen Worte an.
Das Geschwätz endet bald.
Aber die Liebe bleibt bestehen!
Ich weiß nicht warum, bis jetzt kann ich es mir nicht erklären, wie mir in den Kopf gekommen ist, die Schallplatte aufzulegen und auf die Platte zum Ton des Liedes „Geschwätz ...“ - unter beifälligen Kommentaren meines Cousins - zu dieser unerwartet einprägsamen Show zu pinkeln.
Diese Glanznummer hat uns beide so begeistert, dass eine Wiederholung nicht lange auf sich warten ließ.
Es vergingen Tage. Die Platte drehte sich immer langsamer und langsamer. Im Zimmer breitete sich der Geruch von Urin aus.
Zur gleichen Zeit strich Tschernisch durch die Dorfstraßen und schnappte dort etwas auf, was einen schweren Durchfall verursachte.
Aus der Stadt kam Kotja, um mich zu besuchen, und fand ein deprimierendes Bild unseres Sommerurlaubs vor: Im Hof entleerte sich ohne Unterbrechung der arme Tschernisch und aus dem geöffneten Fenster klang Katzenmusik. Das war die Sängerin, die mit ihrer Bassstimme heulend das Lied „Geschwätz...“ im Tempo einer Schildkröte sang.
-----
Wir fühlten uns immer wohl bei Opa. Als wir klein waren, setzte er kein Erziehungskonzept durch, er gab uns alle Freiheit, überzeugt davon, Kinder muss man verwöhnen.
Sein Interesse an der Psychologie des Lebens und den geopolitischen Prozessen der Welt formten sein ausgeprägtes Innenleben. Für ihn war es interessant, über das Leben im Ganzen zu sprechen, es aus der Sicht eines Analytikers zu betrachten und nicht aus der eines Spießbürgers, der sich über kurzfristige existenzielle Fragen beunruhigt.
Wie viele faszinierende Gespräche hatte ich mit ihm in der Küche als ich größer wurde und anfing in die Themen, die Großvater interessierten, einzudringen! Oft merkten wir beide nicht, wie die Zeit verflog, wie drei oder vier Stunden rasend vergingen. Meine glückliche Vergangenheit! Der jähe Wechsel des Schicksals nötigte meinen Großvater, distanziert und vorsichtig die sowjetische Gesellschaft wahrzunehmen. In den 20er Jahren kämpfte er gegen mittelasiatische Banditengruppen „Basmatschi“ und war Politoffizier. Ebenfalls in den 20ern und zu Beginn der 30er Jahre war er in der Abwehr, der er mit großem Risiko im Jahr 1931 entflohen war.
Im Jahr 1937, als das sowjetische Repressionssystem seine eigenen Kader zerrieb, stand er an der Grenze zum Arrest, denunziert als Präsident der Stadtverwaltung (Bürgermeister) eines kleinen Städtchens in der Ukraine. Er bereitete sich auf das Schlimmste vor und rasierte sich den Kopf, weil er wusste, dass das NKWD (Innenministerium der UdSSR) zur Folterung nicht nur die Finger in Türen presste, sondern auch an Haaren zog. Er hatte Glück. Er wurde nicht verhaftet, aber von seinem Posten als Bürgermeister enthoben.
Über diese schwarze Zeit habe ich viel von meinem Großvater gehört, unter anderem eine eindrucksvolle Statistik der Repression: Von 54 Präsidenten der Stadtverwaltungen des Donbass Kohlebeckens blieben nur zwei am Leben – mein Großvater „und noch ein Alter“ – so wurde es von ihm formuliert.
Mein Opa war Jude. Er kam aus einem kleinen jüdischen Städtchen in Weißrussland. Die Atmosphäre dieser Gegend ist der Welt dank der Erinnerungen und den Bildern von Chagall bekannt. Ich erinnere mich immer noch an einige dieser Geschichten aus dem Leben meines Großvaters. Nachdem er als Bürgermeister entlassen wurde und die Sinnlosigkeit und Gefahr des Daseins im System begriff, begann er zu studieren, und machte drei Hochschulabschlüsse, zwei davon extern. Im Jahre 1953, vor dem Tode Stalins, wurde mein Großvater der Gründung einer zionistischen Organisation beschuldigt, und demzufolge von der Verteidigung seiner Dissertation ausgeschlossen.
Die dramatischen Verhältnisse seines Lebens, sein Naturtalent als Analytiker und seine feste Vorstellung von Moral, führten ihn zu anderen Erkenntnissen, führten ihn auf einen anderen Weg.
Erkenntnis, Selbsterkenntnis und Familie – seine Liebe, seine Stärke – waren sein Lebensinhalt.
Als Opa starb, gingen Mutter und ich in eine leere Wohnung in einem der weit entfernten Wohngebiete, nicht mehr in Swerdlowsk, sondern schon in Jekaterinburg, wohin sie mit Oma wegen einer Generalsanierung in ihrem alten Haus umgezogen waren.
Außer schiefen Möbeln, alten angestoßenen Tellern und Tassen gab es nichts in der Wohnung.
Wir waren damals sehr arm.
Vom Boden hob ich ein kleines Stück Papier auf und las in der Handschrift meines Großvaters:
„Die Wahrheit weiß nicht der, welcher vor seine Füße sieht, aber jener, welcher nach der Sonne weiß, wo er hingeht“
(L. Tolstoi)
*
Unser zweites Lager war drei Stunden Fahrzeit vom begehrten Hannover entfernt. Warum zog es uns unbedingt nach Hannover? Ganz einfach: Wir sind es gewohnt, in großen Städten zu wohnen. Hier unterscheidet sich die sowjetische Vorstellung stark von der europäischen – je weiter weg vom Zentrum des Landes, vom Zentrum der großen Städte desto schlechter das Leben. Zentralisierung durchdrang alles, selbst die geringfügigste Lebensstruktur. So war es einst in meinem Land.
Und auch jetzt sind Moskau und Petersburg Land in einem Land – der Unterschied ist noch sehr, sehr groß.
Deshalb fiel die damalige sowjetische Provinzialität auch sofort auf. Früher unterschieden sich Hauptstadtmenschen vom Äußeren her von Provinzlern, nicht zuletzt durch ihre zwanglose Art. Zur Peripherie gehörte alles, was nicht Moskau und Petersburg war.
Auch meine Heimatstadt Swerdlowsk, bevölkert mit fast zwei Millionen Menschen, galt als Provinz.
Diese Auffassung trug zu einem bemerkenswert zynischen System namens „Versorgungskategorie von Nahrungsmitteln und anderen Konsumgütern für die Volksversorgung“ bei.
Dank der „Humanität“ einer solchen Verteilung des Nötigsten aus der zentralen Futterstelle, wurden Moskau und die Hauptstädte der sowjetischen Republiken unvergleichlich besser versorgt als beispielsweise Swerdlowsk, in dem zu Beginn der 70er Jahre - bis zur berühmten Reform von Präsident Jelzin, die er die gemeinsam mit dem stellvertretende Premierminister Gaidar einleitete - die Bürger in den Geschäften kein Fleisch mehr sahen.
Es wurde einfach aus der Lebensmittelration des Proletariats gestrichen.
Fleisch gab es in Swerdlowsk nicht mal in der Zeit der „Talone“ für Lebensmittel. Diese „elegante“ Bezeichnung sollte von der Assoziation mit den Lebensmittelkarten im zweiten Weltkrieg ablenken.
Des Rätsels Lösung war einfach: Zu den Städten „1. Versorgungskategorie“ gehörten die Städte, die von Ausländern besucht wurden. Sie sollten die bedauerungswerten Zustände eines großen Teils der Bevölkerung unseres Landes nicht sehen.
Überhaupt, das Erscheinen eines Ausländers in Swerdlowsk war so etwas wie ein Wunder.
Soweit ich mich erinnern kann, war in der Breschnew-Zeit der Zugang für Gäste aus dem Ausland, abgesehen von Ausnahmen, verboten.
Die Menschen stellten sich in Reih und Glied in die Schlangen, die Verkäufer schrieben die Reihenfolge mit Nummern auf die Hände der Kunden, damit nicht betrogen werden konnte. Die schrecklichste Form der Tortur war das Stehen in der Schlange bei jedem Wetter. Schlangen gab es kilometerlang über eine Anzahl von Wohnvierteln hinweg. Viele seufzten: „Macht nichts, Hauptsache kein Krieg!“
So verbrachten Opa und Oma viele Stunden in der Schlange. Nach der stundenlangen Qual des Stehens brachten sie anschließend ihre Ausbeute zu uns.
Damals waren sie schon gut über 80 Jahre alt.
Tatsächlich war das Gefühl eines nahenden Krieges und die Angst vor der Möglichkeit eines bilateralen Atombombenangriffs zwischen der UdSSR und Amerika groß.
Dieses Gefühl wurde durch die Propaganda gezielt angeheizt, um die Unruhe der Bürger, die in den Schlangen standen, auf eine externe Bedrohung zu lenken.
Neues Lager, neues bürokratisches Bett, schlichte Gebrauchsgegenstände für das erträgliche Leben, drei Betten – doppelstöckig, eines auf dem anderen, und ein Einzelbett auf der anderen Seite an der Wand stehend. Tisch und drei Stühle.
Vor dem Fenster eine katholische Kirche und alle 15 Minuten Glockenläuten. Das war unsere Unterkunft, in der uns drei Monate bevorstanden.
Es gab noch eine Halle, wo sich die Bewohner der Gruppenunterkunft zum Fernsehen versammeln konnten, sowie Toilette und Dusche.
Eine normale Bedingung für abgehärtete „Sowjets“ mit Kommunalwohnungsvergangenheit.
Nicht schlechter und nicht besser als damals. Aber unsere Petersburger Kommunalka werde ich dennoch nicht vergessen…
*
Busja und Kotja,ihr armen… Niedergeschlagen vom Tod meines Vaters, ihres Sohnes, der nicht als erster starb - da war noch der kleine Gerotschka, er verschied an plötzlichem Kindstod - entschieden sie sich, von Swerdlowsk wegzugehen, und tauschten eine warme Zweizimmerwohnung im stalinistischen Stil gegen ein Zimmer in einer überfüllten Leningrader Kommunalka.
Das Zimmer wurde mit einer Furnierwand unterteilt, aus einem wurden zwei gemacht. Diese engen Zimmer nannte man „Federkasten“.
Die Entscheidung, Swerdlowsk zu verlassen, fiel schwer – hier blieb der geliebte Enkel und das Grab ihrer Söhne zurück.
Gleichwohl nach Leningrad wollten sie, denn dort lebte und arbeitete ihr jüngster Sohn als Schauspieler (Papas Bruder und mein Onkel). Er hatte keine eigene Bleibe und sie konnten ihn nun mit einer festen Unterkunft in einem „Federkasten“ der sieben-Zimmer-Kommunalka, die gegenüber dem ehemaligen Atelier von Repin am Prospekt Rimski-Korsakow lag, versorgen.
Zu dieser Zeit war kein Kauf oder Verkauf von Wohnungen in unserer Gesellschaft „des entwickelten Sozialismus“ möglich. Kaufen konnte man nur in so genannten Kooperativen, was außerordentlich schwierig war! Alle anderen Möglichkeiten im Bereich „Unterkunft“ waren mit Warteschlangen verbunden. Das Gleiche traf für Fahrzeuge zu.
Warteschlange - das Symbol der Epoche Breschnew: Die Warteschlangen für eine Wohnung und ein Auto konnten sich Jahrzehnte hinziehen.
Eine Erlaubnis benötigte man auch für den Tausch einer Wohnung in einer Provinzstadt gegen eine Wohnung in Moskau oder Leningrad. Gott sei Dank, zwischen alten Dokumenten von Busja und Kotja fanden wir eine früher erhaltene Bescheinigung über ihr Leben in Leningrad vor dem Kriege.
Die Bescheinigung diente als Voraussetzung für die bürokratische Bewilligung zum Wohnungswechsel.
Sie gingen 1929 von Astrachan nach Leningrad und wohnten an der Ecke Pestelstraße und Liteyny Prospekt im berühmten Haus Muruzi. In diesem Haus lebte der 1940 geborene Poet Josef Brodsky. Dieses Haus war auch das Elternhaus meines Vaters, der 1937 geboren wurde.
Während des Krieges ging Kotja zur Landwehr, schützte die Stadt vor den Truppen Hitlers auf den Pulkowski Höhen Leningrads. Später wurde er schwer verletzt und gemeinsam mit der Familie in den Ural evakuiert. (Übrigens, die Eltern meiner Mutter wurden ebenfalls evakuiert, allerdings aus der Ukraine in den Ural. So bin ich in gewissermaßen ein Kind der Evakuierung.)
Kotja und Busja waren von Kunst begeistert. Keiner von ihnen hatte einen Hochschulabschluss, gar nicht zu sprechen von einer professionellen Schauspiel- oder Musikausbildung. Trotzdem waren sie künstlerisch begabte Persönlichkeiten. Ihr Haus war nicht nur großzügig, gastfreundlich und „lecker“, sondern auch musikalisch. Sie liebten es, zu singen, klassische Musik zu hören, sei es in der Philharmonie, im Radio oder später im Fernsehen.
Zwei Jahre nach dem Umzug von Busja und Kotja nach Leningrad begann ich sie zu besuchen. Damals kam ich das erste Mal in die ungewohnte Umgebung einer Leningrader Wohnungskommunalka. Auch wenn junge Menschen sich leichter anpassen können als Erwachsene, wenn sie mit ungeeigneten Lebensbedingungen konfrontiert werden, war das Leben in einer Wohnung mit vielen Menschen, die gemeinsam eine Küche und eine Toilette benutzten, anfangs sehr ungewohnt. Ich hörte aber ziemlich schnell auf, mich an den Besonderheiten des „Gemeinschaftswohnungsparadieses“ zu stoßen, denn hinter der düsteren Hausmauer im Bezirk Kolomna lag ganz Leningrad - festlich, aufregend und verlockend. Damals war für mich sogar die Kommunalka schön. Solange ich nicht in Leningrad wohnte, war ich einfach ein Schulkind in den Schulferien bei Busja und Kotja.
Und sie waren es, die aus meinem Besuch ein Fest machten.
Sie und Leningrad.
1:1
Ein professioneller Reflex treibt uns stets, nach einem Musikinstrument zu suchen, wo auch immer wir uns befinden.
Leider gelingt es nicht allen Musikern, ihr Musikinstrument mitzunehmen. Das konnte sich der berühmte Horowitz leisten! Aber was sollen wir, die Normalsterblichen machen?
Es geschah an unserem zweiten Aufenthaltsort in Deutschland:
Freunde namens Schick, die am anderen Ende des Landes lebten, versuchten die Situation per Telefon zu klären. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wer uns den Rat gab, den Apotheker zu fragen. Aus mir unverständlichen Gründen sollten wir den Apotheker nach dem Schlüssel für die Schule fragen, die während der Sommerferien leer stand.
In der Schule gab es ein Klavier.
Später stellte sich heraus, dass die Frau des Apothekers an dieser Schule Musik unterrichtete. Zuerst mussten wir aber herausfinden, wo sich die Apotheke befand und wie der Apotheker hieß. Jeder Kontakt mit deutschen Einheimischen erforderte damals von uns eine Anzahl von Proben.
Wir mussten uns bemühen, unsere Bitte richtig zu formulieren und dabei - möge uns Gott davor schützen - keinen Fehler bei der Aussprache des Namens dessen zu machen, den wir ansprechen wollten.
Die Apotheke fanden wir. Als wir aber den Namen des Inhabers auf dem Ladenschild lasen, wurde uns schlagartig klar, dass keiner von uns dreien bereit war, ihn anzusprechen.
Das Problem war, dass sein Name bei richtiger Aussprache einem anstößigen russischen Wort entsprach, mit dem männliche Geschlechtsorgane bezeichnet werden.
An diesem Tag rief uns Schick an und sagte: „Ich habe eine Information wegen des Instruments. Der Schlüssel befindet sich beim Apotheker, aber ich möchte dir gleich sagen, er heißt „....…“. “Diese bedauerliche Tatsache ist mir schon bekannt…“, antwortete ich ihm.
Natürlich konnte keiner der Einheimischen, einschließlich des Apothekers, wissen (eine Chance zu Hundert!), welche Bedeutung dieser Familienname in der russischen Sprache hat. Das war nicht das einzige Problem...
Der Name reizte zum Lachen, das war die Sache! Es war ein schreckliches physiologisches Etwas, das stärker war als ich.
Gott, wie oft verriet mich dieser Reflex, wie oft geriet ich deswegen in peinliche Situationen, nicht in der Lage, den Lachvulkan unterdrücken zu können, der die dünne Körperhülle gemein durchbrach, der erschütterte und zu Tränen und Krämpfen trieb.
Es war Zeit zu entscheiden, wer von uns beiden, Julia oder ich, sich an ihn wenden sollte.
Ich habe mich nicht sehr männlich verhalten – Julia übernahm diese schwere Mission.
Obwohl Sie versuchte, sich die Peinlichkeit zu ersparen, nicht gewohnt, Worte, die nicht druckreif sind, zu verwenden, wandte sie sich an die netten Kollegen des Apothekers und bemühte sich, den Namen etwas eleganter auszusprechen, indem sie einen Buchstaben einfach wegließ.
Natürlich konnte sie niemand verstehen und sie wurde solange gefragt, bis sie rot angelaufen ehrlich den ganzen Familiennamen bis zum letzten Ton aussprach. Ich erstickte vor Lachen. Den Schlüssel erhielten wir. Der Apotheker und seine Frau stellten sich als sehr liebe Menschen heraus.
Apropos, in unserer Gemeinschaftsunterkunft, die im Wohnviertel der berüchtigten Apotheke lag, wohnte jemand, der wie wir neu angekommen war. Er lebte dort gemeinsam mit seiner Familie.
Sein Familienname war Fickman. Wir konnten einfach nicht verstehen, warum er und seine Familie von der Leiterin der Unterkunft immer mit „Fischman“ angesprochen wurde.
Nur aufgrund unserer erweiterten Deutschkenntnisse wurde uns klar, dass sie - wie Julia bei dem Apotheker - versuchte, Peinlichkeiten zu vermeiden.
Warum? (Diversion)
Ich weiß nicht warum, irgendwann in der vierten Klasse der Spezialmusikschule des Konservatoriums von Swerdlowsk gingen wir, ich und mein Kumpel, Igor Ponomarjow, ein rothaariger Hooligan mit abstehenden Ohren, zur Stadtverwaltung – einem majestätischen Gebäude auf dem Zentralplatz in Swerdlowsk, gebaut von deutschen Kriegsgefangenen – und setzten die Männertoilette so unter Wasser, dass es durch die Decke zwei Stockwerke tiefer herunterfloss.
Mit unseren Pionierhalstüchern sahen wir beide sehr vertrauenswürdig aus - alle Pioniere mussten vorschriftsmäßig diese Halstücher tragen - wir erzeugten nicht den geringsten Verdacht.
Wir gelangten unter dem Vorwand, Makulaturen einzusammeln, in das Verwaltungsgebäude. Damals wurden Schüler verpflichtet, eine bestimmte Menge Altpapier für die nationale Wirtschaft zu sammeln; übrigens auch Metall.
Gott weiß, was uns wegen unseres kindlichen Rowdytum hätte passieren können! Hätte man gewollt, uns der ideologischen Zersetzung zu bezichtigen, wäre es ganz einfach gewesen, uns schwer zu bestrafen.
Zum Glück konnten wir schnell abhauen.
Es herrschte allgemeiner Tumult in der Stadtverwaltung.
Warum? (Schaden am Sowjetischen Handel)
Ungefähr zur gleichen Zeit stahlen wir mit einem anderen Kumpel aus meiner Klasse, Aljoscha Skworzow, Badezimmerputzmittel in einem Supermarkt und gingen in den nächsten, wo ich es in die Tasche eines Anzugs, der verkauft werden sollte, leerte. Aber dieses Mal war es nicht möglich, der strafenden Hand des Gesetzes zu entkommen. Wir wurden gefasst und auf die Polizeistation gebracht.
Von dort holten mich die Tante und der Cousin ab.
Derjenige, mit dem ich gemeinsam auf dem Schrank aufwuchs.
Zwischenbemerkung
Die Zivilisation erweckt bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Gefühle, unter anderem Skepsis…
Aber der Mensch ist schwach. Wie angenehm ist es, einen BMW zu fahren, durch die weltweiten Computernetze zu reisen, sich schön anzuziehen…
Ich bin ein Modenarr. Ich bin bereit, alle „Klamotten“ täglich zu wechseln – so wie viele Frauen – damit an jedem Tag ein neues „Ich“ entsteht, meinem gestrigen nicht ähnlich…
In der verkrusteten sowjetischen Gesellschaft redete man uns ein: Der Mensch, der keine Berührung mit der Kultur hat, ist ungehobelt in der Kommunikation, schlecht erzogen und grob…, und wir nahmen zur Kultur Kontakt auf.
Zivilisiert zu sein, hieß ins Theater, ins Museum und ins Konzert zu gehen.
Aber warum sind dann zehntausende, hunderttausende Menschen, die in der heutigen technokratischen Welt leben, so akkurat und sozial angepasst, wenn sie niemals mit Kultur in Berührung kommen, am Morgen zur Arbeit fahren, am Abend vor dem Fernseher sitzen, höflich sind und gut riechen?
Uns wurde doch gesagt, dafür müsse man Mahler hören und Modigliani genießen…
Das alles bringt mich manchmal zu dem traurigen Schluss, dass wir alle in einem postkulturellen Raum existierten.
Die Glocke bringt mich um den Verstand… eine viertel Stunde – einmal, zur halben Stunde – zweimal, zur dreiviertel Stunde – dreimal... und so drei Monate lang. Oh Gott...
Näher zur Kirche als wir, wohnt niemand. Und es regnet, regnet, regnet…
Ich schwebe zwischen Realität und Traum. Traum wie ein Film. Man möchte sich bequemer hinsetzen, so wie im Kino, und in die Geschichte eintauchen.
Liebe und Schn√ľrstiefel
Der erste September rückte näher, der Beginn des neuen Schuljahres. Im Jahr davor kamen Neue in die Klasse.
Es kamen einige Schüler, die die normalen Musikschulen beendet hatten und nun zu uns wechselten, um professionelle Musiker zu werden. Unter ihnen war „Sie“. Das vergangene Jahr hatten die Neuen nicht die allgemeinen Fächer besucht, sondern nur die musikalischen, deswegen sahen wir uns nicht regelmäßig.
In der Nacht zum 14. August 1977 erschien sie mir im Traum. Es war nur ein einziges Bild – ihr Kopf mit nach hinten zurückgenommenem Haar. Es war aber genug, um zu wissen: Ich kann nicht ohne sie leben!
Irgendwie musste ich den 1. September erreichen! Die Zeit bis dahin war kaum auszuhalten!
Manchmal habe ich den Eindruck, dass der Grund für die Explosion von Gefühlen die Liebe selbst ist, die in uns lebt, und nicht die Menschen, in die wir uns verlieben. Liebe reift, sie sucht einen Ausgang und findet am Ende das Objekt ihrer Verwirklichung.
So ist auch der russische Spruch zu verstehen: „Liebe ist böse, man verliebt sich auch in einen Ziegenbock.“ Nun, wie kann ein Ziegenbock Liebe hervorrufen? Der Auslöser ist nicht der Bock. Die Liebe ist böse. Sie wartet.
Diesen Sommer war ich in Leningrad, war zum ersten Mal in einem Urlaub mit Busja allein, nicht bei Kotja, ihn gab es seit April nicht mehr. Sein Herz konnte einen erneuten Infarkt nicht verkraften.
Busja kleidete mich ein. Ich mochte es von Kindesbeinen an, „In zu sein“.
In diesem Sommer kaufte sie mir Schuhe von „Skorochod“ aus rot-gelbem Lederimitat. Nach Meinung des Designers sollten sie entfernt an die damals in Europa modischen Schuhe mit Plateausohlen erinnern, die auch bei uns brennenden Neid auf jeden Glücklichen hervorriefen, der so etwas hinter dem „eisernen Vorhang“ auftreiben konnte. Ich will hier erwähnen, dass ich damals so langsam wuchs, dass meine Größe in der 9. Klasse nur 1,56 m betrug.
Diese geringe Größe war umso dramatischer, da sich alle rund um mich herum stürmisch entwickelten und reiften. Die Klassenkameraden wurden zu Jünglingen und Fräuleins, und ich war immer noch ein Knabe mit dünner Stimme und Schuhgröße 36. Der unerwarteten Empfindung einer im Herzen geborenen großen Liebe kamen die Schuhe wie gerufen. Mit ihnen war ich 3 cm größer. Der erste September kam näher und meine Aufregung beim Gedanken, sie zu treffen, wuchs. Nein, es war nicht Verliebtheit, es war ein Orkan von Gefühlen.
Bekanntlich decken Orkane Dächer ab. Und so geschah es mit mir! In dieser heißen Erregung erfand ich eine Möglichkeit, größer zu sein. Unglückselig! Ich verstand damals nicht, dass ich mich zu zwei Jahren Qualen verurteilte.
Die Schäfte der Herbst- und Winterschuhe waren hoch genug. Deshalb überlegte ich mir, noch etwas hinein zu legen, um noch größer zu sein. Ich grub alle alten Schuhe aus, schnitt die Absätze ab und legte je einen in meine neuen Schuhe.
Die Anprobe ergab ein deutliches Ergebnis: Ich war 6, ja fast 7 cm größer!
Jetzt vor der Angebeteten zu stehen, war nicht mehr so qualvoll.
Zu Beginn des neuen Schuljahres erhielt ich Komplimente, wie sehr ich im Sommer gewachsen sei, auch wenn ich noch immer zu meinen Klassenkameraden aufsehen musste. Doch dank meiner sommerlichen Erfindung hatte der Abstand etwas abgenommen.
Am ersten Tag nach dem Unterricht nahm ich „ihre“ Fährte auf – sie flanierte mit ihrer Freundin, ich versuchte mich zu nähern. Ich musste ziemlich lange warten, während sie spazierten, auf einer Bank im Park saßen und sich dann endlich verabschiedeten. Der historische Moment meiner ersten Liebeserklärung fand neben dem Wasserrohr statt, das vom Dach ihres Hauses herunterführte.
Von Gegenliebe ihrerseits konnte keine Rede sein. Doch aufzuhören, um sie zu werben, war unmöglich.
Und unmöglich war es auch, aufzuhören, mein Wachstum zu imitieren. Die Anzahl der Absätze in den Schuhen vermehrte sich. Bei der Feingliedrigkeit meiner Figur entstand ein immer eigenartigerer Anblick meiner Beine, die scheinbar aus dem Kopf herauswuchsen. Ihre nicht proportional zum Rest des Körpers erscheinende Länge, und vor allem der gestelzte Gang, erweckten Aufmerksamkeit, ich kam ins Gerede. Die bis oben hin gefüllten Schuhe hielten dagegen: Vom Aufbäumen des Ristes zerrissen die Schnürsenkel. Ich ersetzte sie durch dicke weiße Stricke. Wenn ich mich hinsetzten wollte, standen die Hosen weit über den Schuhen ab, meine Hosen waren einfach zu kurz! Ich entwickelte ein ganzes System von Tricks, um den Betrug zu verstecken. Mit meinen Schuhen, die sich in richtige Stelzen verwandelt hatten, lernte ich nicht nur auf die Pedale des Flügels zu drücken, sondern auch in der Schuldisco zu tanzen, wobei ich mit meinen dünnen, unglaublich langen Beinen die Umstehenden streifte.
Gefahr lauerte besonders am Wochenende, wenn ich meine Beine ausruhen ließ und Klassenkameraden auf der Straße treffen konnte. In diesen Fällen sprang ich auf das Trottoir oder umgekehrt, sprang einige Stufen hinunter, nur um nicht auf gleicher Höhe mit meinen Gesprächspartnern zu sein, weil sonst eine Entlarvung unvermeidlich gewesen wäre, denn „das Podium“, auf dem ich mich bewegte, erreichte 15 (!) cm. Noch gefährlicher war es, jemanden zu besuchen. Schuhe, die von der Straße dreckig waren, zog man üblicherweise aus. Ich zog sie nicht aus.
Die Liebe ließ mich nicht los. In dieser Zeit wurde unser Verhältnis so ernsthaft, dass es zu Küssen in ihrem Hausflur kam. Und auch als sie mir zu Beginn des nächsten Schuljahres sagte, sie liebe mich nicht, setzte ich fort, wie man so schön sagt, mit der Hoffnung zu leben.
Zu Beginn der 11. Klasse wurden meine Gefühle allmählich schwächer.
Die Absätze in den „gequälten“ Schuhen der Leningrader Fabrik „Skorochod“ wurden Stück für Stück niedriger.
Ich begann ungestüm zu wachsen.
-----
An einen so langen Sommer wie den ersten Sommer in Deutschland kann ich mich nicht erinnern...
Vielleicht noch die drei Monate in den Sommerferien während der Schulzeit, obgleich im Juni die mittleren Klassen meiner Spezialmusikschule unterrichtet wurden.
Das Leben stand still wie ein Flugzeug vor dem Abheben. Stand uns wirklich ein Start bevor?
Und wenn ja, in welche Richtung des Lebens?
Dem Vakuumgefühl des Lagerdaseins versuchten wir tapfer mit Üben am Piano in der Schule und durch Deutsch lernen in unserem Zimmer Farbe zu geben.
Aus Protest gegen unsere Entscheidung, das Land zu verlassen, weigerte sich der 14-jährige Igor in Petersburg Deutsch zu lernen. Jetzt lehrten wir ihn selbst – die Grammatik war uns schon fast erschlossen, und wir zogen ihn und ein Nachbarsmädchen nach.
Die Mutter dieses Mädchens war eine törichte Jüdin aus Omsk mit napoleonischen Plänen für die Zukunft ihrer Familie. Sie erzählte Märchen über einen Mann, der gegen eine bestimmte Provision jede Form von Arbeit in Deutschland finden könne. Unsere Sorge um ihre Tochter berührte kurzfristig ihre Gefühle. Begeistert versprach sie Hilfe bei der Bewältigung unseres nicht leichten Schicksals. Ihre Begeisterung verflog so schnell wie sie entstand. Der Mann dieser „kreativen Person“ sollte sich angeblich als der einzige Russisch sprechende Rechtsanwalt in Hannover niederlassen. (Es gibt, das wissen wir jetzt, mehr als genug!)) Und überhaupt, die ganze Zeit hatte sie aus einem unergründlichen Grund vor, „sich nach Süden zu bewegen“. Alleine das Wort „Süden“ hörte sich aus ihrem Mund magisch an. So sprach sie: „Man muss sich „nach Süden“ bewegen!“
Unsere anderen Nachbarn waren ein schrulliges Paar: Mutter und Sohn aus der Ferne Kirgisiens. Den Sohn sah ich häufig unerwartet an unterschiedlichen Plätzen manisch Sport treiben. Er lernte mit einer durchaus originellen Methode Deutsch: Er schrieb das Wörterbuch ab. Während unseres Zusammenseins waren es schon fünfundsiebzigtausend Wörter. Doch die Redewendungen, die er benötigte, um im Notfall mit den einheimischen Deutschen Kontakt aufnehmen zu können, bestanden nicht aus fünfundsiebzigtausend Wörtern, nicht einmal aus sechs.
Deshalb haben wir für ihn einige „geflügelte Worte“ zusammengestellt. Seine Mutter fiel uns durch ihre goldenen Zähne und schwarzen Leggins auf, die sie bei jedem Wetter trug.
Es gab auch noch andere „Kameraden im Unglück“, die neben uns lebten. An alle kann ich mich nicht mehr erinnern.
Einer kam mitsamt den Möbeln an, ein anderer versuchte direkt mit den „sowjetischen Lagerinsassen“ Geschäfte zu machen.
Ein junges Pärchen aus Moldavien verbrachte viel mehr Zeit in der Dusche, als für die persönliche Hygiene notwendig gewesen wäre, und kam von dort fröhlich und erhitzt zurück. Mehrmals boten sie uns „einen günstigen Kauf“ von Gegenständen an.
Ich konnte nicht verstehen, warum in dieser Zeit die russischen Massenmedien von „Braindrain“ (Abwanderung der Intelligenz) als besonderes Problem sprachen. Es kann sein, dass ich einfach kein Glück hatte, aber ich habe zwischen den uns damals Umgebenden nicht einen einzigen schwer Kopflastigen gesehen.
Der Sommer war verbrannt. Es begann die Zeit der Düngung.
Ätzend, der Geruch löste Brechreiz aus.
Die Kirchenglocken schlugen unerbittlich alle 15 Minuten.
N.E.
Nathan Efimowitsch (Perelman) sah ich zum ersten Mal „fliegend“ Richtung 10. Klasse im 1. Stock des Petersburger, damals Leningrader, Konservatoriums. In diesem Raum unterrichtete schon sein Lehrer, Professor Leonid Wladimirowitsch Nikolaew, der auch der Lehrer von Sofronitsky, Judina, Schostakowitsch, Serebrjakow und anderen hervorragenden Musikern war.
Ich kam am 27. April 1980.
Mein Schicksal stand vor einer plötzlichen Wende.
Zu Nathan Efimowitsch brachte mich meine Mutter. Ich sollte das Examensprogramm für die Aufnahme am Konservatorium spielen, und er sollte mir sagen, ob ich damit rechnen könne, falls ich aufgenommen würde, in seine Klasse zu kommen. Eine übliche Praxis in unserem Beruf.
Ich sage es gleich, ich habe ihm damals nicht gefallen. Mein provinzielles Auftreten, meine Vortragsweise, mein Ausdruck und Temperament, konnten sein Interesse nicht wecken.
Ich fuhr niedergeschlagen von Leningrad zurück nach Swerdlowsk, obwohl ich die Einladung von
Nathan Efimowitsch erhielt, im nächsten Jahr nochmals zu zeigen, was mir bis dahin gelingen würde.
Genau nach einem Jahr kam ich abermals - und die Frage meiner Aufnahme war entschieden.
Im September 1981 wurde ich Student des legendären Perelman.
Wie konnte ich damals wissen, dass das Treffen mit ihm ein Segen und eine Verwandlung war – nein, nicht in Freundschaft, in Liebe, eine wirkliche gegenseitige Liebe zwischen Lehrer und S√ϬĀhüler…, die mich zwanzig lange Jahre begleiten würde, das Glück neben ihm zu sein – bis zum letzten Wort, das er mir ins Ohr hauchte, drei Tage vor seinem Tod im Krankenzimmer der militärmedizinischen Akademie im Jahre 2002.
Diese zwanzig Jahre waren ein Wunder. Denn in die Klasse von Nathan Efimowitsch kam ich, als er fünfundsiebzig Jahre alt war.
Nun kommt die Zeit, mich an Sie, mein lieber Lehrer, auch mit diesen Zeilen zu erinnern. Welche Angst hatte ich vor diesem Augenblick!
Wie zitterte ich innerlich bei dem Gedanken, dass Sie schon fünfundsiebzig Jahre sind, dann achtzig, neunzig und fünfundneunzig… Am Konservatorium bat ich das Schicksal, es möge mir die Möglichkeit geben, bei Ihnen zu Ende zu studieren.
Aber es ist etwas Größeres geschehen - Sie füllten mein Leben in einem solchen Maße aus, dass Sie es selbst wurden - mein Leben.
Es lag nicht nur an der Musik. Ich lernte lieben das, was Sie liebten. Mein ganzer Tag war mit Gedanken an Sie ausgefüllt,
an Sie und die reale Verbindung mit Ihnen. Ich konnte zu jeder beliebigen Stunde mit meinem Schlüssel Ihre Wohnungstür in dem alten Petersburger Haus in der Tschajkowsky Straße 63 öffnen, Sie im Sommer in Lettland besuchen, mit Ihnen und Ihrem Sohn im gemieteten Zimmer mit dem Garten vor dem Fenster, wo der Jasmin blühte, übernachten.
Auf unseren langen Spaziergängen in Leningrad Ihren spannenden Erzählungen über die Geschichte des ausgehenden Jahrhunderts zuhören, dessen Teilnehmer Sie waren – über das Treffen mit Pasternak, über die Freundschaft mit Gilels, Schostakowitsch, Glasunow, der sich so schmeichelhaft über Sie äußerte – jetzt lese ich in Büchern darüber.
Ihr Treffen mit Präsident Tito, Ihre Unterhaltung bei Spaziergängen nahe Warschau mit Antonov-Ovseenko...
Ihr Foto mit ihm – behutsam bewahre ich es.
Wie die vielen Geschichten, die Sie mir allein anvertrauten.
Ich bewahre Sie.
An jedem Tag meines Lebens.
------------
Nach Leningrad brachte ich den Minderwertigkeitskomplex des Provinzlers mit.
Alles erschien mir hier vortrefflicher als in Swerdlowsk. Und alle waren nicht wie ich – sie waren besser als ich.
Meine Kommilitonen schienen mir wesentlich gewandter zu sein als ich, auch das Einleben unter den neuen Bedingungen war nicht einfach. Es lag nicht am Kollektiv, es lag an mir.
So war es immer. In der Kindheit konnte eine bevorstehende Bekanntschaft Erschrecken bei mir auslösen, bis hin zu Tränen. In einer „Taucherglocke“ zu sein, ist mir auch heute noch lieb.
Die Einsamkeit der ersten Monate des Studiums am Konservatorium war trotzdem mehr oder weniger wohltuend. Sie erlaubte mir, mich besser auf die Übungen zu konzentrieren, was wichtig war, denn Nathan Efimowitsch testete mich zunächst und verhielt sich mir gegenüber sehr zurückhaltend.
Der professionelle Einfluss von seiner Seite war groß, und es ist unmöglich, die Qual des ersten Unterrichts im Beisein von Zuhörern der „Fakultät für höhere Qualifikation“ zu vergessen, mit denen unsere Klasse oft überfüllt war - wie ein Bus in der Rush-hour.
Diese Ansammlung von Menschen war für meinen Lehrer kein Anlass, aus dem Unterricht eine Show zu machen, womit übrigens viele bekannte Pädagogen sündigten, darunter auch der geniale Neuhaus, bei dem Nathan Efimowitsch in den 20er Jahren studierte.
Mein Lehrer konnte stundenlang an einer kleinen Episode arbeiten, an zartesten Nuancen, er ging in seiner Arbeit bis zu elementaren „Schuldetails“, und dies führte bei den Studenten zu einem beträchtlichen Unwohlsein, besonders im Beisein des großen professionellen Auditoriums.
Als Provinzler entdeckte ich für mich immerhin etwas sehr Wertvolles in der großen Stadt:
Wir waren „unter vier Augen“. Wir mussten uns „beschnuppern“ – ich und meine aufs Neue aufgetauchte Umgebung, die mir im Herbst vollkommen anders erschien als damals im Sommer des Jahres 1977.
Plötzlich verstand ich, dass mich Leningrad nie wieder freigeben wird.
Jetzt zeigte sie mir ihren wechselhaften Charakter: Feuchtigkeit, Wind, Dunkelheit und ich, der Einsame.
An den Wochenenden, wenn Behörden und Geschäfte geschlossen waren, war sie arm und leer.
Und ich wanderte durch die Labyrinthe des schmutzig abgebröckelten „Dostojewski-Viertels“ und erkannte die in seinen Romanen beschriebenen Häuser, Höfe und Torbögen.
Petersburg ist wie ganz Russland, wenn Sie hoch auf die Kuppel der Isaak Kathedrale steigen, dann sind Sie auf einer Seite von glänzenden goldenen Turmspitzen und Kuppeln am Ufer der Newa geblendet und auf der anderen Seite öffnet sich Ihrem Blick das düstere grau-braune Zickzack mit den dunklen engen Hinterhöfen.6
Glanz und Elend .
Niemals wieder in meinem Leben besuchte ich mit solcher Intensität Konzerte und Theateraufführungen. Vieles, was ich sah und hörte, ist heute schon Geschichte. Einiges davon unvergesslich...
Das häusliche Leben bestimmte die Kommunalwohnung, in der wir mit Busja – alt und jung – in unseren zwei „Federkasten“ lebten. Üben konnte ich zu Hause – Vaters DDR-Klavier war noch in der Lage, den großen Werke der klassischen Musik standzuhalten.
Wie übrigens auch die Nachbarn.
Busja, die nach dem Tod ihres Sohnes an Diabetes litt, sie war fast blind, saß auf einem alten Sofa und hörte meinem Spiel zu.
Hinter dem Fenster polterten alte Straßenbahnen über den Repinplatz.
Für uns ergab sich die glückliche Gelegenheit, das Lager verlassen zu können. Wir fanden Makler, schlaue Jungs aus der Ukraine. Für „bescheidene“ tausend Mark fanden sie für uns eine Dreizimmerwohnung im Stadtviertel List in Hannover.
Im Lager hielt man uns lange zurück. Die Leiterin erklärte dies damit, dass man uns unsere Aufenthaltsbewilligung noch nicht ausgestellt habe, und ohne diese verständlicherweise ein unabhängiges Leben nicht möglich sei.
Später stellte sich heraus, dass die Aufenthaltsbewilligung schon lange fertig war. Warum sie uns länger schmoren ließen, ist nur Gott bekannt.
Endlich kam der Umzug! Mit unserem gesamten Eigentum – drei Koffern! – kamen wir in das neue Stadtviertel.
Ich erinnere mich an unser erstes Abendessen in unserem neuen leeren Zuhause.
In der dunklen Küche, es gab keine einzige Lampe, auf einem Bettbezug auf dem Boden der Küchenfliesen, mit einer Flasche Wein und einem einfachem Essen – lachten wir.
Glücklicher Einzug!
*
Sich an Leningrad zu gewöhnen, ist ein schwieriger Prozess.
Ich wollte nach Hause.
Dort fiel das Atmen leichter, und wie ein hauptstädtischer Modenarr herausgeputzt vor den ehemaligen Mitschülern zu erscheinen, war eine angenehme Nebenerscheinung. In den ersten Jahren meines Leningrader Lebens benutzte ich jeden Anlass, um nach Swerdlowsk zu reisen.
Dazu trug auch eine beträchtliche Menge von Feiertagen bei, die der kommunistischen Ideologie zu verdanken waren und die jeweils einen kleinen Urlaub möglich machten.
Anfang November 1982 flog ich nach Swerdlowsk. Am 7. November feierte das Land „65 Jahre Oktoberrevolution“.
Der 7. November war schon vorbei, aber ich war noch immer dort, wärmte mich neben meiner Mutter und meinen damals 7-jährigen Zwillingsschwestern, ging zu Opa und Oma, führte lange Gespräche mit ihnen, traf mich mit meinem Cousin und meiner Tante.
Am 11. November verbreitete sich in der Stadt eine trübe Stimmung. Den Grund dafür konnte niemand nennen.
Von früh morgens an spielte das Radio klassische Musik, im Fernsehen wurden Ballett und russische Landschaftsgemälde gezeigt.
Vorgesetzte riefen die nächsthöheren Vorgesetzten an, man munkelte, dass in der Nacht der Generalstab zusammentreffen und danach etwas Wichtiges mitteilen würde. Wie immer in unserem Land wurde nur die Bevölkerung nicht informiert und war deswegen voller Unruhe.
Ich ging ins Konservatorium, um ehemalige Kommilitonen zu sehen. Zufällig traf ich in der Kantine die Frau meines ehemaligen Professors und fragte sie, ob sie nicht wisse, was geschehen sei. „Man sagt, das Haupt habe ins Gras gebissen!“, war ihre Antwort.
Das Oberhaupt in dieser Zeit war der vom ausschweifenden Leben zerstörte Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Leonid Iljitsch Breschnew, der schon lange nicht mehr richtig lebte und sich mit letzter Kraft dahinschleppte.
Die Neuigkeit war bestürzend. Ein Wechsel an der Führungsspitze unseres Landes war immer auch ein Vorbote des Wandels. Welcher Wandel erwartete uns?
Die Mehrheit erwartete ein Anziehen mit „Daumenschrauben“.
Auf der Treppe des Uraler Konservatoriums trafen wir einen Komsomolaktivisten. Er kam aus dem übergeordneten Parteibüro zurück, wohin alle Aktivisten beordert wurden.
Er wurde gefragt: „Was ist los?“
„Was ist los, was ist los…, Leonid Iljitsch ist tot. Das ist los!“, sagte er mit tränenreicher Stimme. Die Fragenden gaben sich Mühe, nicht zu lachen. Der zynischen Macht wurde es mit gleicher Münze heimgezahlt...
Bis in die tiefe Nacht standen wir trotz der Ausgangssperre wegen des Todes „des Häuptlings“ noch lange in der menschenleeren Straße vor dem Haus meiner Freunde, den prominenten Moskauer Schauspielern, Juri Lachin und Lena Borisowa, und lachten schallend.
Die Zukunft war unklar.
Nicht vergessen
Auf die Nörgelei der einheimischen Intelligenz über den Zustand des eigenen Vaterlandes antworte ich immer mit der Frage: „Wer sagt dass dieses Land für uns ist?“
Ich verstehe, ein Land sollte allen gehören...
Und doch …,die „anderen“ sind immer in der Mehrheit, und so wird es bleiben.
Für einen „klassischen“ Musiker wäre es absurd, Anspruch auf volle Stadien mit kreischenden Fans zu erheben, was durchaus normal für jeden noch so erfolglosen Popsänger ist.
Iljin3 schrieb: Intelligenz ist geprägt durch Ideen und Ideale, ist aber nicht zu begründen.
Nicht zu begründen... Weder hier noch dort fühlen wir uns in unserer eigenen Haut wohl –
unsere eigene Haut selbst ist uns nicht behaglich. Ganz geschweige denn eine fremde…
Sowjetisches Leben verband alle mit allen, unterbrach die Verbindung zwischen den Zeiten.
Vermischte historische Epochen der unterschiedlich existierenden Gesellschaftsschichten – unterschiedlich der jeweiligen Zeit entsprechend.
Zerstörte die hart aber weise strukturierte vierzehnstufige Gliederung.
Jeder konnte in das Leben des anderen eindringen und Regeln durchsetzen, die mit dessen Vorstellungen nicht übereinstimmen mussten.
So geschieht es auch bei ethnischen oder zwischenstaatlichen Konflikten – bei Konflikten gleichzeitig existierender Zivilisationen.
Es sind jedoch Konflikte zwischen den unterschiedlichen historischen Epochen.
Das wirkte sich auch im privaten Leben aus. So geschah es mir. Mir und meiner Mutter. Niemals werde ich die Kränkungen und Erniedrigungen des „anderen Mannes“ vergessen. Nie vergesse ich das neben mir existierende Fremde und Böse.
Mit den Jahren wächst Gras über die Kränkungen.
Zurück bleibt Abscheu…
----------
Deutschland ist ein wunderschönes Land. Mit dem Öffnen seiner Türen für eine sehr große Anzahl von Menschen, die sich hier niederlassen wollen, übernimmt der Deutsche Staat die Verantwortung für sie. Damit sie auf eigenen Füßen stehen können, gibt er ihnen das Notwendigste für den Anfang ihres Weges zur Integration.
Dieses deutsche Minimum war das Maximum für viele Ankömmlinge mit sowjetischer Prägung.
Für uns auf alle Fälle! Unsere Armut ging wegen der schmerzhaften Veränderungen in der russischen Gesellschaft fast bis an unsere Grenzen. Und das alles trotz intensiver professioneller Tätigkeit.
Julia denkt bis heute mit Dankbarkeit an einen Straßenbahnkontrolleur, der ihr spät am Abend mit dem kleinen Igor eine kostenlose Fahrt an die Stadtgrenze von Petersburg, wo wir lebten, erlaubte. Als sie ihm ihr leeres Portemonnaie zeigte, winkte er nur mit der Hand. Er handelte menschlich. Es gab aber auch andere …
Und trotzdem bin ich davon überzeugt: Materielle Probleme gibt es nicht. Es gibt psychologische. Schwacher Mensch - wenn du einen „Trabant“ hast - von einem Auto hättest du früher nicht zu träumen gewagt! - und dein Nachbar einen VW, dann bist du schon bereit, dich als arm zu bezeichnen.
Und bist bereit, dein „misslungenes“ Leben zu beweinen.
Wir waren einst tief unglücklich in unserer Kommunalka, aber wir hatten ein Dach über dem Kopf. Es gab welche, die keines hatten. So gesehen, waren wir Glückspilze.
Das menschliche Bedürfnis, sich „einzurichten“, erstaunt mich.
Viele widmen dieser einfältigen Beschäftigung ihr ganzes Leben. Richten sich so gründlich und leidenschaftlich ein, als ob vor ihnen die Ewigkeit läge. Dabei ist jedem, der es sich gemütlich macht, das unumgängliche Ende bekannt.
In einer der kleinen Straßen von Wiesbaden, im Schaufenster eines Beerdigungsinstituts, wird anrührend naiv ein luxuriöser Sarg ausgestellt – eine Werbung für die Dienstleistung und eine Erinnerung an den „zukünftigen Aufenthalt“.
Großvater richtete sich nicht ein. Nathan Efimowitsch richtete sich nicht ein. Meine Mutter richtet sich nicht ein.
Das Wiederfinden in einer Wohnung in Hannover nach dem „Lagerleidensweg“ war Glück.
Wir sind alleine! In einer nicht großen, aber angenehmen Dreizimmerumgebung.
Wir haben liebe ältere Nachbarn. Mit Blick auf unsere nackten Wände bringen sie uns als Geschenk Haushaltsgeräte, interessieren sich für unser Leben, erzählen von ihrem.
Deutsch zu sprechen ist immer noch eine peinliche Qual!
Dieses scheußliche Gefühl aus dem Mund fallender schlampig gemalter Stummel von nicht richtig ausgesprochenen Worten... Schrecklich peinlich, wenn man nicht in der Lage ist, sich so auszudrücken, wie man ist. Das ist es, das „Mittel gegen Arroganz“.
Das bist du, du, ein „bekannter Petersburger Musiker“, rot geworden vor Anstrengung und Scham vor deinem Gesprächspartner. Du, der einst so mondän, redegewandt und geistreich warst, quetschst jetzt ein Wort pro Minute heraus.
Richtig sprechen sollte man in jeder Sprache. Ich teile die enge Ansicht, eine Sprache nur als Mittel zur Kommunikation zu nutzen, keineswegs. Sehr viele Emigranten verkünden: „Sprich ohne Angst, Hauptsache man versteht dich!“
„Hauptsache“ reicht nicht. Dies lehrte uns die Deutschlehrerin in Petersburg. So dachten wir und denken wir noch heute.
In den Sprachkurs mit dem Namen „Arbeit und Leben“ gingen wir gut vorbereitet. Der Unterricht in Petersburg und das Sprachtraining während des monotonen Sommers im Lager waren erfolgreich. Schlimmer war es bei Fernsehsendungen, Telefongesprächen und generell beim „hören“.
Ich erinnere mich an einen Spaß, den ich mir immer wieder mit meiner Familie erlaubte, indem ich das deutsche Fernsehprogramm auf das türkische umschaltete und dann auf ihre Reaktion wartete. Sie kam manchmal ziemlich spät.
Es gibt Gemeinschaften, auf die man keinen Einfluss hat und Menschen, die man sich nicht aussuchen kann, wie bei der Armee, im Lager und jetzt im Deutschkurs in Hannover. Alle Gruppenteilnehmer vereinigte nur eine Formalität: das Hochschuldiplom. Die anderen Kriterien trafen bei weitem nicht für alle zu.
Erstaunlich, von der großen Mehrheit wurde die gewährte staatliche Hilfe – Mietzahlung, Geld für Nahrungsmittel, Sprachkurse – ohne das geringste Anzeichen von Dankbarkeit - nicht nur als selbstverständlich aufgenommen, sondern löste auch Kritik aus. Die Unzufriedenheit vieler Kursteilnehmer mit dem allzu schnellen Tempo des Unterrichts führte zu Konflikten mit den Pädagogen und anderen Sprachschülern, die besser vorbereitet waren und ihre Zeit nicht der Inanspruchnahme zusätzlicher staatlicher Sozialgelder widmeten, sondern ernsthaft die Sprache lernten als Mittel für ein neues Leben.
Diese sowjetische Bereitschaft, sich durch „betteln“ zu erniedrigen – Echo vergangener Armut – jagte Landsleute durch Behörden mit der Bitte um ein kostenloses Fernsehgerät oder um die Zahlung für ein Kindermädchen für Teenager. Bei der Nachricht, es gibt ein Angebot von Joghurt zum Schleuderpreis im Lebensmittelgeschäft in der Nachbarschaft, waren sie vom Unterricht wie „weggeblasen“..
Einige wurden bei kleinen Diebstählen von Hähnchen und Videofilmen ertappt.
Die fieberhafte Suche nach weggeworfenen alten Möbeln, Computern und anderen Haushaltsgegenständen nahm ihre Gedanken und ihre Zeit in Anspruch. Es war beschämend.
Unser Dasein wurde zu dieser Zeit durch eine große Freude bereichert: Wir kauften ein Klavier.
Der fürsorgliche Freund Schick erreichte einen seriösen Preisnachlass. Er empfahl uns, ein Klavier zu kaufen, auf dem man mit Kopfhörern spielen konnte - eine geniale japanische Erfindung zum Schutz der Nachbarn. Ein hervorragendes akustisches Instrument, das sich durch einfaches Drücken des Pedals in ein elektronisches verwandelt, und dabei den natürlichen Klang nicht verliert.
Der gesamte Erlös unserer Petersburger Wohnung wurde für dieses Instrument ausgegeben.
Es blieben fünfzehn Mark übrig, das reichte, um das „freudige Ereignis“ zu feiern und eine gute Flasche Rotwein für ein Bankett zu dritt zu kaufen.
Im gleichen Jahr – 1982 - genau einen Monat nach Breschnew, verstarb Busja.
Einige Monate vor ihrem Tod fiel in einem der „Federkasten“ die Decke herunter. Die alte Leningrader, vielleicht auch Petersburger, Stuckatur hielt nicht stand. Diese Gefahr bestand schon lange. Über Jahre kroch ein tiefer diagonaler Riss durchs Zimmer, doch niemand von uns war aufmerksam genug.
Der Schlag war von zerstörender Kraft. Das kreideweiße Gesicht von Busja werde ich nie vergessen.
Ich denke, das Geschehen brachte sie dem Ende näher.
Die ganze Nacht vom 9. auf den 10. Dezember saß sie nur da und fasste sich ans Herz, aber sie weckte mich nicht. Wie taktvoll, wie konnte sie das nur tun? Dachte sie daran, dass ich am nächsten Tag ein Vorspiel am Konservatorium haben sollte?
Am Morgen rief ich den Krankenwagen und meinen Onkel an.
Der Arzt des Krankenwagens verabreichte ihr eine Spritze, nach der sie endgültig zusammenbrach. Verzweifelt fing sie an, nach Atem zu ringen. Mein Onkel kam, wir trugen Busja zum Krankenwagen für Kardiologie und fuhren ins Krankenhaus.
Im Krankenhaus ging alles sehr schnell zu Ende. Sie wurde dreiundsiebzig Jahre alt.
Am Abend spielte ich das Konzert. Spielte gut. Der aufgeregte Nathan Efimowitsch fütterte mich mit Beruhigungsmitteln.
Drei Tage danach, am Abend vor der Beerdigung von Busja, wurde ich zwanzig Jahre alt.
Zu zweit – nur mit meiner Mutter, die aus Swerdlowsk kam - tranken wir am Trauertisch auf meinen Geburtstag.
Ich blieb im „Federkasten“ alleine zurück.
In der Zeit um 1970, als Kanzler Willi Brandt vor dem Denkmal des Warschauer Gettos auf die Knie fiel und seine Bußworte sprach, gehörte Antisemitismus in meinem Land, das das judenfeindliche nazistische Regime besiegt hatte, zum Alltag.
In der Stalinära gab es ihn offiziell nicht, obwohl geplant war, die Juden in den „Hinterhof“ des Landes umzusiedeln. Der Antisemitismus war sozusagen hausintern. Seine Wurzeln waren nicht nur Stalinismus, Kommunismus oder andere wirre Ideologien, sie lagen viel tiefer.
Antisemitismus war auch unter den russischen Intellektuellen verbreitet, darunter auch bekannte russische Schriftsteller.
Aber die alltägliche Abneigung gegen Juden in der sozialistischen Gesellschaft hatte kaum etwas mit deren ideologischen Konzeption zu tun. Man liebte keine „Gebildeten“; das war Praxis, keine Theorie.
Zu Juden wurden oft diejenigen gezählt, die eine „Brille“ trugen, einen „Hut“ hatten oder einfach nicht „von dieser Welt“ waren. „Sei einfacher und du wirst akzeptiert!“, so lautete ein Sprichwort.
Auf meinem Schulweg rief ein angetrunkener Mann: „Du, Jude!“ Ich war elf oder zwölf Jahre, doch ich erinnere mich bis heute daran.
Die Auseinandersetzung mit unserer jüdischen Abstammung war schmerzhaft, ungeachtet der Vermischung von russischem mit weißrussischem Blut bei mir und meinem Cousin. Das Thema durchdrang unser Leben.
Mein Großvater, Aron Abramowitsch, blieb bis zu seinem Ende Aron Abramowitsch.
Seinen Töchtern aber zwang er zu ihrer eigenen Sicherheit einen anderen Vatersnamen auf. Beide nannten sich „Arkadjewna“. Er wusste, in welchem Land er lebte. In der Schule verschwieg ich Vornamen und Vatersnamen meines Großvaters. Ich schämte mich.
Hätte ich mich geschämt, damals ein Kind, für den Vornamen und den Vatersnamen des von mir so geliebten Menschen, wenn es in meinem Land des „proletarischen Internationalismus“ nicht beschämend gewesen wäre, Aron Abramowitsch zu sein?
Würden Sie nicht auch, wenn Sie wie ich ein „Mischling“ wären, bei zwei möglichen Alternativen für die Eintragung der Nationalität in den Personalausweis, dessen vorgeschriebenes Attribut der 5. Paragraph - die ethnische Zugehörigkeit – ist, sich für „Russisch“ entscheiden?
Ich erinnere mich, dass uns Großvater, der sich mit dem Ausstellen unserer ersten Pässe beschäftigte, mit der „Drohung“ neckte, „Hebräer“ hinschreiben zu lassen.
Eine der kleinen Geschichten aus meinem Leben war ein Brief von einem einfachen russischen Burschen, der seine Mutter über die Hochzeit mit einer Jüdin informierte. Die Notwendigkeit, die Nationalität der Frau zu erwähnen, mit der er sein Schicksal verbinden wollte, war aufschlussreich…
Die des Lesens und Schreibens kaum mächtige Mutter, die am Stillen Ozean, an der Peripherie des Landes lebte, entschloss sich, ihren Sohn aufzumuntern und schrieb zurück:
„Das macht nichts, mein Sohn. Sie sind auch Menschen ...“
Immerhin – Menschen.
Auch.
Wie Großvater das hasste! Wie gut kannte er diese verrostete Ideologie, die Schuldige sucht und Menschen wegen ihres schnarrenden „r“ und ihrer Hakennasen demütigt… wegen ihrer Namen und Vatersnamen... wegen der „internationalen zionistischen Verschwörung“... wegen des verhassten Landes Israel, das gegen unsere Freunde, die Araber, kämpft.
Interessant nur, dass in den postkommunistischen 90er Jahren die ultrarechten Antikommunisten ebenfalls von einer Verschwörung der Juden sprachen. Nun nannte man sie etwas offener „Jiddische Freimaurer“. Wer waren diese Freimaurer? Kein Bürger in der sich rasch demokratisierenden Gesellschaft wusste es.
Dafür war allen das Wort „Jidd“ von Kindesbeinen an bekannt. Die Situation war schizophren – wie viele „Isaak Mendelewitsch Gochman“ waren russisch, zumindest ihrem Pass entsprechend!
„Schlagen, nicht nach dem Pass, aber nach der Fresse..., jauchzte der sowjetische Antisemit.
In diesem Sinne schlug man... nicht nach dem Pass...
In den 50er Jahren waren für den Pianisten Nathan Efimowitsch, der sich auf dem Höhepunkt seines Ruhmes befand, die großen städtischen Konzertsäle geschlossen. Damals zahlte er Provision an Konzertmanager für die Organisation seiner Konzerte an den Randgebieten des Landes.
Das Gesicht meines Großvaters lief rot an: „Ich hasse jene, die ihre Beziehung zu einem Menschen nach der nationalen Zugehörigkeit bestimmen!“ Er war offen für alle.
Und antwortete den Russen auf ihren Antisemitismus nicht mit Hass - und litt nicht unter dem Komplex der jüdischen Überlegenheit. Ich traf auch auf solche Menschen, sogar auf große Organisationen.
Sie waren stolz auf das, was nicht ihr Verdienst war - auf ihre Nationalität.
Rawil Martynow, ein hochtalentierter Dirigent, mit dem mich mein professionelles Schicksal glücklich verband, ein glühend-schwarzer Tatare, der hautnah die nationalistische Abneigung gespürt hat, sagte über Kämpfer für das „reine Blut“: „Sie haben nur eine Nationalität: „Talentlosigkeit“
Auszug aus der Lektion über die Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion im Uraler Konservatorium 1980:
„Mitglieder der Leninregierung waren Trotzki (Bronschtein), Kamenew (Rosenfeld), Swerdlow, der Jude, nach dem unsere Stadt benannt wurde“.
No comment.
Meine Zugreisen
Die Schwierigkeit, ein neues Leben in einem anderen Land zu beginnen, umfasste nicht nur die Unumgänglichkeit, in einer fremden Sprache zu kommunizieren und sie zu verstehen, sich adäquat zu verhalten und bestehende Gesetze nicht zu übertreten, mit denen wir in Deutschland noch gar nicht vertraut waren, die Schwierigkeit lag auch an der umfassenden Veränderung der Tätigkeit für eine bestimmte Periode unseres Lebens…
Ein Künstler, der seit Jahrzehnten jeden Tag am Klavier sitzt, Konzerte gibt, in vielen Orten gastiert, vielgestaltig organisiert, spürt die schwere bleierne Eintönigkeit fremder nicht gewohnter Handlungen.
Das Selbstempfinden eines „Künstlers“ baute dabei äußerst schnell ab! Der tägliche achtstündige Deutschunterricht zog den Boden unter unseren Füßen weg, wir mussten uns wehren! „In der Luft hängen“, das wäre leicht, „In der Luft hängen“, das durfte aber nicht sein.
Gott sei Dank, blieben die vor der Abreise abgeschlossenen Konzertpläne in Kraft.
Im Spätherbst fuhr ich nach Dänemark zum Konzert.
Mein erster Nachtzug im Ausland.
Zauberhaft! Die Tür des Abteils öffnete und schloss sich lautlos. Eine lächelnde tadellos angezogene Schaffnerin glitt an den Passagieren vorbei, die Bettwäsche war schneeweiß. Der Zug rauschte mit großer Geschwindigkeit Richtung Kopenhagen. Das gewohnte Rattern der Zugräder war nicht zu hören.
Den Geruch von Bahnhöfen kenne ich seit meiner Kindheit. Und die Erinnerungen an Bahnhöfe sind immer verbunden mit einer riesigen hektischen Menschenmenge, mit Schmutz und vom Koffertragen müden Händen.
Wie gemütlich reisten wir im Coupé zu viert - mit Opa, Oma und dem Cousin! Wie lecker war im Zug das Essen, das zu Hause nicht geschmeckt hatte. Gewöhnliche Sachen bekamen in dem sich bewegenden Haus eine neue Bedeutung...
Die oberen Betten waren heiß begehrt, der Kampf um sie verursachte Streit. Wenn man schon nicht darin schlafen durfte - die Erwachsenen erlaubten es nicht, oben zu schlafen, aus Angst, dass eines der Kinder im Schlaf herunterfallen könnte - dann wollte man wenigstens am Tag oben sitzen oder eine Weile liegen.
In der Kindheit gab es viele Züge. Mit Busja, dem Onkel, dem Vater und der Mutter fuhren wir ans Schwarze Meer. Mit Oma machten wir eine Reise von Swerdlowsk nach Leningrad und von dort nach Moskau und zurück nach Swerdlowsk. Damals sah ich zum ersten Mal Leningrad und Moskau und dort – Lenin im Mausoleum!
Zu meinen Reisen gehörten auch die Reisen zwischen Leningrad und Moskau in der Studentenzeit. Der Studentenrabatt reduzierte den Fahrpreis enorm. Für unbequeme Waggons mit einfachen Sitzplätzen konnte man eine Reise nach Moskau und zurück für 10 Rubel kaufen.
Was ich auch tat.
In den Sommermonaten wurden die überfüllten Züge von Menschen gestürmt, die keine Fahrkarten hatten.
In der Regel konnte man den Schaffner bestechen und in seinem Abteil oder auf den Gepäckregalen mitfahren. So fuhr ich einmal auf einem engen Gepäckregal, versteckt vom Zugführer unter einer Decke, von Leningrad zu Nathan Efimowitsch nach Lettland, wo er viele Jahre Urlaub in Saulkrasti bei Riga am Meer machte.
Es gab auch Reisen von Gastspiel zu Gastspiel. Zu Beginn der bettelarmen 90er Jahre versuchten viele russische Agenten, bei Gastspielen zu sparen, und zwängten die armen Künstler in schmutzige Waggons, wo man auf Seitenbrettern neben undichten Toiletten schlafen musste.
Einmal reiste ich mit meinem Onkel nach Jekaterinburg mit dem Zug.
Zu der Zeit wohnte ich schon in Deutschland. Ich fuhr nach Jekaterinburg zu Konzerten und mein Onkel zu einem Treffen mit seinen alten Schulfreunden.
Wir richteten uns prächtig ein – im Schlafwagen. Es herrschte grimmiger Winter, wir tranken Cognac, unterhielten uns, sahen zum Fenster „auf die Heimat“ hinaus.
An die Fahrt erinnere ich mich auch wegen einer urkomischen Szene beim Halt in Perm. Es war spät am Abend. Draußen fror es Stein und Bein wie in meiner Kindheit.
Ich stieg aus, um eine Zeitung zu kaufen, und als ich zurückkam, sah ich meinen Onkel in seinem langen herrschaftlichen Lammfellmantel neben dem Zug stehend. In seiner Hand hielt er einen Trichter, eigentlich eine Klistierspritze, die laut einer „poetischen“ Reklame „für die Heilbewässerung des Rektums und des Dickdarms“ geeignet war. Bewässerung! Mit dem Schlauchende des „Trichters“ hantierte die Schaffnerin unseres Waggons unter dem Zug. Es stellte sich heraus, dass man mit warmem Wasser die Toiletten der einheimischen Eisenbahn auftaute.
Mein Onkel und ich mussten noch lange über diesen Vorfall lachen. Auch deshalb, weil das solide Aussehen meines Onkels mit den neugierigen Blicken der vorübergehenden Passanten, die sein Gesicht aus dem Kino kannten, und der Konzentration, mit der er gemeinsam mit der Schaffnerin die Operation „Bewässerung“ durchführte, stark kontrastierte…
Es gab auch eine dramatische Reise mit dem Zug von Moskau nach Petersburg.
Nach Moskau fuhren wir damals gemeinsam mit Vadim Bibergan, um an einem Festival des Komponistenverbandes teilzunehmen. Das Konzert wurde vom Publikum warm aufgenommen, unsere Laune war hervorragend.
Nach dem Konzert besuchten wir Wladislaw Kazenin, den Vorsitzenden der Komponistenvereinigung Russlands, ein enger Freund und Klassenkamerad von Bibergan und meinem Vater.
Der Abend in seinem gastfreundlichen Haus war warm und nach russischer Tradition mit „Salz und Brot“ bereichert.
Um 1.00 Uhr nachts fuhr mein Zug vom Leningrader Bahnhof in Moskau zurück nach Petersburg.
Bei meinem Erscheinen im Coupé saß dort schon eine kleine Gruppe von fröhlichen geselligen jungen Männern. Etwas später kam ein Mädchen dazu. Der Rausch des erfolgreichen Konzerts und die Vorliebe für das bekannte russische Getränk führten dazu, dass ich mich vergnügt an den Gesprächen beteiligte und die angebotene Bewirtung meiner Reisegefährten annahm, die unerklärlicherweise aus geschälten Limonen bestand.
Plötzlich gab es mich nicht mehr.
Am Morgen erwachte ich, von unbekannten Männern in einem sonst leeren Eisenbahnwaggon aufgerüttelt. Die Beine gehorchten nicht, ich konnte nicht aufstehen. „Sie wurden vergiftet und ausgeraubt!“, Mit diffusem Bewusstsein hörte ich Stimmen. Starke großgewachsene Männer stellten mich auf die Beine. Der Koffer, mein treuer Begleiter, in dem der Anzug für die Konzerte „mitreiste“, war aufgeschlitzt.
Die Brieftasche mit dem Moskauer Honorar gestohlen. In ihr – mein Gott! – auch die Geburtsurkunde von Igor.
Außerdem waren die Schuhe weg. Die Diebe verschwanden mit ihnen. Zum Glück hatte ich noch die Konzertschuhe, nicht ganz der Jahreszeit entsprechend – es war November – aber immerhin besser als nichts.
Man schleppte mich zur Sanitätsstation am Moskauer Bahnhof in Petersburg. Die Krankenschwester schlug vor, mir eine Spritze zu geben. Mein verschwommener Verstand reichte aber aus, abzulehnen, wer weiß, was sie mir gespritzt hätte.
Die Polizei verhörte mich ungeachtet meines „halbschwebenden“ Zustandes direkt auf der Straße, sie lehnten meinen willenlosen Körper einfach an die schmutzige Bahnhofswand.
Keiner kam auf die Idee, diesen Menschen mit den „Wattebeinen“ nach Hause zu bringen. Ich kroch bis zur Metro und wachte eine Station zu spät auf.
Mein Erscheinen zu Hause war ein Schock. Mit dem Krankenwagen wurde ich in die Toxikologische Abteilung eines Petersburger Krankenhauses eingeliefert, wo ich die nächsten 24 Stunden mit einer Infusion zwischen Drogensüchtigen und anderen Vergifteten lag.
Zwei Krankenzimmer, für Frauen und Männer, lagen nebeneinander. In der Nacht hörte ich im Schlummer heftige unflätige Diskussionen und die Geräusche von stürmischem Liebesspiel. Der neben mir liegende Kaukasier „half“ einer älteren Krankenschwester, wobei er ihr eine Spritze aus ihren zitternden Händen riss und mit geübter Bewegung den Inhalt in seine Venen spritzte.
Ich tauchte auf und wieder unter. Während einer dieser tiefen Tauchgänge sah ich auf einmal meinen Vater, so wie einst, wenn wir im Winter gemeinsam spazieren gingen – im Lammfellmantel und einer Wintermütze mit Pelz.
Er nahm mich fest bei der Hand und wir rutschten auf einer weißen Schneekruste.
Am nächsten Morgen bat ich den Arzt, mich nach Hause zu entlassen. Er entließ mich sofort. Alleine konnte ich nicht nach Hause kriechen. Schwäche... Mein Onkel mit seinem Auto half.
Später habe ich erfahren, dass ich, wie auch meine Nachbarin im Coupé, mit Klofelin, einem stark wirkenden Blutdrucksenker, vergiftet wurde. Irgendwie fand sie meine Telefonnummer heraus, rief mich an und erzählte, dass die Polizei davon ausgegangen sei, ich würde eine solche Überdosierung nicht überleben und hätte mich wahrscheinlich in eine andere Welt begeben.
Heute denke ich, vielleicht hat mich mein Vater von der weißen Schneekruste weggeführt…
In den 90er Jahren waren Vergiftungen in Zügen eine wunderbare Möglichkeit, jemanden auszurauben - ohne persönliche Anstrengung der Diebe. Ein tiefschlafender Mensch fühlt nicht, wenn er nackt bis auf die Haut ausgezogen wird!
Die Räuber hatten keinerlei medizinische Kenntnisse.. Meist gaben sie den Opfern eine viel zu hohe Dosis Beruhigungsmittel in Tee, in Alkohol oder wie in meinem Fall mit einer Spritze in eine Limone. Und Opfer waren ausreichend vorhanden…
Man darf sich nicht im Zug von Fremden bewirten lassen …
Nach einigen Monaten fuhr ich wieder mit dem Zug. Diesmal nach einem Konzert in Jekaterinburg auf dem Weg zu einem Konzert in Tjumen.
Meine Reisegefährten – ein nettes Ehepaar – feierten Geburtstag und luden zum Champagner ein.
Ich habe nicht abgelehnt...
-------------
Im Winter riss ich mich von Hannover los und floh nach Petersburg. Gefühlsaufwallungen überkamen mich und trübten meine Augen. Vor Freude über die Rückkehr war alles in Aufruhr. Unser neues Leben war uns – mir viel mehr als Julia – noch immer fremd.
Julia nimmt das Leben anders. Im Gegensatz zu mir, dem immer dies und das nicht passt, nimmt sie das Leben wie eine Aufgabe wahr. Wie eine wichtige Aufgabe, der man mit Verantwortung begegnen muss. Sie lebt, indem sie diese Aufgaben konsequent und sanft erfüllt.
In dieser Milde liegt Weisheit.
Und wieder bin ich in meinem kalten ungemütlichen Petersburg. Alle meine „deutschen“ Jahre werde ich hierher kommen und leben. Eben leben, und wenn es nur für eine Woche ist, ganz egal – leben...
An einem düsteren Petersburger Morgen in meiner kleinen Einzimmerwohnung aufzuwachen, die von der früheren, größeren, eine Bibliothek, das Klavier meines Vaters und später nach dem Tod meines Lehrers seinen Flügel „geerbt“ hat, ist wunderbar - in dieser netten kleinen Petersburger Wohnung – eine Welt der Erinnerungen und Gegenstände, die selbst Erinnerungen zu neuem Leben erweckt.
Leben dort und leben hier – zwei verschiedene Lebensarten, die Verwandlung von mir dem einen in mich den anderen – als eine Form der Existenz, als Möglichkeit sich selbst zu retten.
Meinem Ich von hier fehlt mein Ich von dort.
Die Flüchtigkeit, das „Literarische“ des Geschehens, gibt mir die Möglichkeit, Luft zu holen und einzutauchen in ein anderes Leben, solange der Atem reicht. Nicht aufzutauchen, darf ich mir nicht erlauben. Sonst…
In russischen Träumen von einer friedlichen Welt und einem warmen satten Zuhause vergessen wir, dass eine Bleibe dort ist, wo wir ein Obdach haben. Mein Haus – meine Festung. Ein Haus ist dort, wo wir geschützt sind. In einer friedlichen Welt braucht man keine Festung.
In unseren ärmlichen sowjetischen Wohnungen – sogar in den Kommunalkas – war ein solches Zuhause.
In schlechten Häusern, wo Wasser und Elektrizität oft abgestellt wurden, fühlten wir uns geschützt vor der bösen Welt, die uns außerhalb des Hauses mit Ungerechtigkeit, Kälte und Schmutz angriff… Diese Welt endete an der Türschwelle unserer Wohnung, sogar das Treppenhaus lag außerhalb unserer gesicherten Welt. Nur die Wohnung war unsere Festung.
Gehen Sie durch Amsterdam. Schauen Sie in die Fenster der Häuser! Dort gibt es keine Vorhänge, man muss sich nicht schützen. Sich hinter Gardinen zu verstecken, an Nächste anzuschmiegen, weil morgen schon alles zu Ende sein könnte, sich abzuschließen und abzugrenzen – das ist unser russisches Leben... wie es eben ist.
Kommunalka
„Der proletarische Staat braucht zwangsläufig die Einquartierung der darauf dringend angewiesenen Familien in Wohnungen der reichen Leute. Angenommen unsere Miliztruppe besteht aus 15 Personen: 2 Matrosen, 2 Soldaten, 2 pflichtbewussten Arbeitern (von denen nur einer Mitglied unserer Partei oder ihr nahestehend ist), nachfolgend 1 Akademiker und 8 Personen aus der armen Arbeiterklasse, davon mindestens 5 Frauen, Dienstmädchen, Schwerarbeiter u.a. … Die Truppe erscheint in der Wohnung eines Reichen, untersucht sie und macht fünf Zimmer ausfindig für zwei Männer und zwei Frauen“
(W.I. Lenin: „Kann sich die bolschewistische staatliche Macht halten?“)
Busjas Tod veränderte mein Leben grundlegend. Der Unterschied zwischen der einen und der anderen Lebensform war gewaltig. Jetzt lag die Bereitschaft zur Koexistenz mit den zwanzig nebeneinander lebenden Personen bei mir.
Mein juristischer Status war schwierig. Besser gesagt, ich hatte keinen. Ein Jahr meines Lebens in Busjas Zimmern war nicht nur dem Studium gewidmet, sondern auch dem Versuch, die Registrierung für ihren „Federkasten“ zu erhalten.
Trotz des im Gesetz verankerten Rechts auf Registrierung, wurde ich zum Spielball der Beamten, sogar dann, wenn die Ehefrau meines Onkels dabei war – eine bekannte Kino- und Theaterschauspielerin. Ich konnte nichts erreichen!
Gründe für die Absagen wurden entweder überhaupt nicht genannt oder die Papiere wurden mir nur mit dem Kommentar hingeworfen: „Solche wie Sie registrieren wir nicht“. Das typische Verhalten eines Beamten in dieser „wundervollen“ Zeit! Und „solche wie ich“ gingen zur nächsten Instanz, dann zur übernächsten und übernächsten... gesetzliche Gründe für die Ablehnung einer Registrierung gab es keine.
Der Leser fragt sich natürlich, warum ich nicht einfach vor Gericht ging. Die Frage ist logisch, aber für mich unangebracht und höhnisch zugleich. Im bürokratischen sowjetischen Einheitssystem gab es keine verschiedenen Ansichten. Es gab nur eine Auslegung.
Natürlich fungierten Richter und Rechtsanwälte im beschränkten Rahmen der damaligen Rechtsbegriffe, wenn aber „solche wie Sie“ nicht registriert wurden, konnte Ihnen das Gericht mit einem Rechtsanwalt kaum helfen. Man lehnte ab, was bedeutete: So ist es und so muss es bleiben.
Im Grunde genommen war es in großen Städten normal, die Registrierung einfach so, ohne eine Begründung abzulehnen. In dieser Zeit waren Moskau und Leningrad heiß begehrte Ziele einer riesigen Anzahl von Sowjetbürgern, die des schweren Lebens an der Peripherie müde waren und in diese Städte ziehen wollten.
Und so schob der Sowjetische Staat den Dürstenden einen Riegel vor und verhinderte so ein besseres Los. Folglich wurde ich zu einem Menschen ohne Registrierung, der eigenmächtig Wohnraum in einer kommunalen Wohnung am Prospekt Rimski-Korsakow besetzte.
Nach einem knappen Jahr begannen wir mit Julia in der Kommunalka zusammen zu wohnen.
Aufgewachsen in einer separaten kooperativen Chruschowka-Wohnung, man nannte sie auch „Säuglingshemd“, eine Assoziation an die Bekleidung für Babys – bestehend aus einem Eingangszimmer, von dem jeweils zwei kleine Zimmer abgingen, wie Ärmel eines Hemdes - fand sie alles in der Kommunalwohnung schockierend.
Und wie sollte sie es auch anders empfinden, diese beliebig zusammengewürfelte Gemeinschaft von Menschen, die kein gemeinsames Schicksal und unterschiedliche Vorstellungen von Haushaltsgewohnheiten hatten… letztendlich von Sauberkeit!
Ein Milizionär, der Russisch so sprach, dass es schwierig war, ihn zu verstehen, Arbeiter aus der umliegenden Admiraltejsky Fabrik, Ingenieure…
Aus dem Zimmer neben der Toilette flog die Nachbarin Walja, die ungefähr 200 kg wog, durch den Schlag ihres Mannes in den Korridor. Der Aufprall ihres schweren Körpers auf den Parkettboden konnte mit dem Einschlag des Tungusker Meteoriten verglichen werden.
Der Säufer Mischa wurde aus dem Griboedow Kanal gefischt, wohin er durch einen Schlag seines Zechkumpans - auf dem Höhepunkt einer Diskussion - befördert wurde. Seine Frau, die andere Walja, klein und rundlich wie eine Kugel, stand am Morgen am Herd in der Küche, etwas in einem Topf zusammenrührend, und sprach: „Ach …, wenn doch bald Abend wäre, dann kann man schlafen gehen…“
In zwei Zimmern hinter unserer Wand lebten drei Gestalten. Die alte Olga Alexandrowna, deren Mann einst mit der Haushaltshilfe gesündigt hatte, Walja, die Dritte, das Resultat dieser Sünde - insgesamt gab es vier Waljas in unserer Wohnung - und Lenotschka, die Walja nach einem kurzen Abenteuer unehelich gebar.
Olga Alexandrowna war eine der bejahend „Gestrigen“. Ihr edles Gesicht und ihre Hände verrieten ihre Herkunft, sie war eine wunderbare Literatur- und Musikkennerin, ihre Sprache duftete nach alten Zeiten. Lenotschka war geistig zurückgeblieben. Als sie reif wurde, hörte man ihren Schrei: „Ich will heiraten!“ nicht nur in unserer Wohnung, sondern trotz Rattern der Straßenbahn, so laut brüllte sie, auch auf der Straße. Walja trank heimlich und rauchte Zigaretten. Als Olga Alexandrowna altersbedingt anfing nachzulassen, entschied Walja, die alte Dame ins Altersheim zu schicken.
Wenn sie zur Arbeit fuhr, schloss sie Olga Alexandrowna im Zimmer ein, und diese lag dort den ganzen Tag ohne Hoffnung auf Hilfe, ständig in der Angst, dass etwas passieren kann … Auch wenn sie nicht eingesperrt wurde, schaffte sie es nicht, alleine auf die Toilette zu gehen, und lauerte auf jemanden, der wenigstens den überfüllten Nachttopf leeren konnte. Julia half ihr.
Olga Alexandrowna – man muss hier sagen, Gott sei Dank - starb noch vor dem Umzug in ein unwürdiges Altersheim.
Neben der Küche lebte in einem Zimmer eine dreiköpfige Familie. Er, sie und ein Kind warteten jahrelang auf die Verbesserung ihrer Wohnverhältnisse. Sie rechneten damit, ein paar Zimmer in einer anderen Kommunalka oder sogar eine Einzimmerwohnung zu bekommen.
1984 wurde Igor geboren und unser Leben in der überfüllten Wohnung ohne Rechtsgrundlage, besonders aber der Wunsch unserer Nachbarn, die neben der Küche wohnten, nach mehr Raum, wurden für unseren weiteren Verbleib in der Kommunalka zum Verhängnis.
Die Kampagne unserer Nachbarn gegen unseren Verbleib begann. Wir sollten hinausgeworfen werden. Sie dauerte länger als ein Jahr. Fürwahr, die Menschen einigen sich am besten „gegen“ etwas und nicht „für“ etwas. Das „Unternehmen Vertreibung“ aus unserer Wohnung wurde eine Zeit lang zu ihrem Lebensinhalt.
Durch die morschen Wände hörten wir, wie sie sich spät abends bei Walja trafen, eben bei jener, die die alte Dame zu Tode gebracht hatte, und gegen uns den schriftlichen Antrag zur Kündigung bei verschiedenen Gerichten und Wohnungsbehörden vorbereiteten.
Derlei “Gutenachtgeschichten“ begleiteten uns damals. Kurz darauf kamen die ersten Benachrichtigungen vom Gericht. Achtmal!!! wurden wir zum Gericht bestellt. Beim achten Mal, im Beisein der feierlich gekleideten und stark geschminkten Damen unserer Kommunalka und deren Ehemänner mit ihren grauen Gesichtern, hervorgerufen von der kommunalen Gehässigkeit, erklärte ich unseren freiwilligen Auszug.
Bald nach unserem Verzicht zogen die Nachbarn aus dem Zimmer neben der Küche ihren Antrag auf eine eigene Wohnung zurück. Sie erklärten dies damit, dass es langweilig sei, in einer eigenen Wohnung zu wohnen, und besetzten den Thron in unserer „Federschachtel“.
So endete für mich die Periode des Kommunalkalebens. Ich denke, für immer.
Doch, man soll den Abend nicht vor dem Morgen loben …
-------
Mit dem Ende des Deutschkurses endete auch die Unterhaltung mit unseren Kursteilnehmern. Dies war ohne Frage positiv.
Nach dem sechsmonatigen, täglich acht Stunden dauernden, Nebeneinandersitzen, häufig ohne einander zu verstehen oder zu akzeptieren, waren wir ziemlich müde.
Vor uns lag eine ungewisse Zukunft. Es gibt immer irgendetwas. Die Frage ist, was...
Julia ertrug das Vakuum nicht, das nach dem Ende des Kurses entstand, und ging in eine Bibliothek arbeiten. Es gab eine von der deutschen Bürokratie erlaubte Möglichkeit, freiwillig aber nahezu ohne Vergütung zu arbeiten.
Das Leben war noch weit davon entfernt, uns zu erfreuen. Es war noch immer nicht unseres. Und wie auch? Im neuen Land waren wir erst acht oder neun Monate …
Der Onkel war schon zu Besuch, er vermisste uns in Petersburg. Der hannoversche Winter war schon vorüber, der mit 14 bis 15 Grad minus ziemlich hart für deutsche Verhältnisse war. Wir legten die Deutsch-Prüfung ab.
Im Frühjahr wurde Julia unerwartet zu einem Vorspiel an das Opernhaus in Regensburg gerufen.
Und wieder hieß es umziehen - Geld war nicht vorhanden, nur Schulden.
Die für die Wohnung in Hannover gekauften, schon ziemlich verbrauchten, Möbel nahmen wir in Ermangelung eines Besseren nach Regensburg mit.
Ab Herbst waren wir Einwohner von Bayern.
Direkt nach unserem Umzug fuhr ich wieder nach Petersburg - fuhr für lange, um abzutauchen.
Zum ersten Mal reiste ich mit der Eisenbahn durch mehrere Länder. Von Deutschland nach Prag, von dort nach Warschau, nochmals umsteigen und über Weißrussland kam ich am Ende nach Russland.
Ich erinnere mich an die späte Ankunft in Polozk. Auf dem dunklen schmutzigen Bahnsteig begegneten mir nächtliche Gruppen von fluchenden Männern und Frauen, am kleinen Bahnhofsbuffet wurde „sowjetischer Champagner“ für vier Millionen weißrussische „Häschen“4 verkauft.
Eine sonderbare Zeit!
Die Heimat grüßte mich direkt nach dem Grenzübergang mit dem nackten Po einer Frau in gesteppter Wattejacke und Kopftuch, die ihre Notdurft verrichtete.
Es war Spätherbst.
Es stand ein süßes Eintauchen in die Vergangenheit bevor.
Alle, die unsere kleine Einzimmerwohnung in Petersburg betreten, sagen, dass so eine „sowjetische“ Ausstattung im heutigen russischen Leben sehr selten zu sehen ist, geschweige denn in größeren Städten.
Wirklich, dort ist das „konservierte“ Leben der 80er und 90er Jahre. Und in den 80er Jahren war vieles übrig geblieben aus den 70ern und so weiter…
Die alte Wanduhr von Busja, die Bibliothek, in der es unter anderem die gesammelten Werke von Stalin gibt, die ich von Kotja geerbt habe. Der Flügel von Nathan Efimowitsch, der nach dem Tod des Lehrers zu mir zog. Fotografien der Vorfahren, Daguerreotypen - beginnend mit dem Ende des 19. Jahrhunderts.
Meine Vorfahren vonseiten Kotjas waren Kirchengeistliche.
In Astrachan waren sie bekannte Persönlichkeiten. Nachweislich ist der Familienname „Palmov“ eine Wortschöpfung des Kirchenseminars. Offensichtlich wurde er von „Palmwedeln“, die der Engel Gawriil der Jungfrau Maria kurz vor ihrer Himmelfahrt überreichte, hergeleitet.
Der Großvater von Kotja, mein Ururgroßvater, hieß Gawriil Jakowlewitsch Palmov und arbeitete als Vorsteher der Fakultät der Uspenskikathedrale des Kremls von Astrachan. Vor kurzem fand ich eine Erinnerung an ihn im Tagebuch von Taras Schewtschenko, dem mein Vorfahre den Astrachanski Kreml und die Kathedrale zeigte.
Einer der Söhne von Gawriil, Nikolai Gawrilowitsch, war auch Geistlicher und stellte sich gegen die „kommunistische Reformation“ und die Wegnahme kirchlichen Eigentums, die die sowjetische Regierung in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts veranlasste, und rettete das Leben der Kirchendiener vor dem roten Terror.
Der Sohn von Nikolai Gawriilowitsch, Nikolai Nikolaewitsch Palmov, Kotjas Cousin, war auch Absolvent eines Priesterseminars. Er war ein berühmter Professor für Geschichte und Ethnologie der Kalmücken, einer der Begründer der historischen Wissenschaften und Archive in Kalmückien..
Das Museum in Elista wurde nach seinem Namen benannt.
Ich erinnere mich, Kotja war sehr stolz darauf.
Dank der Sowjetischen Regierung und allen damit zusammenhängenden historischen Brüchen endete mit Kotja meine väterliche orthodoxe Linie. Ich wurde nicht einmal getauft.
Manchmal brennt in mir das Verlangen, meine Petersburger Wohnung umzugestalten, dann aber halte ich inne und denke, es ist gut so wie es ist – wenn man schon in die Vergangenheit zurückkehren möchte, muss es diese Vergangenheit auch geben.
Darin liegt das emotionale Streben, das fremde, vielleicht sogar unbewusste Leben fortzusetzen.
Ich werde nichts verändern.
So lebte mein Lehrer.
Jeden Tag pünktlich um 9.00 Uhr ging er zum Flügel. Jeden Tag ab 9.30 Uhr riefen ihn einige seiner Lieblingsschüler an. Für 12.00 Uhr machte Nathan Efimowitsch sich einen Tee. Er erzählte mir entzückt: „Zu dieser Zeit durchdringt die Sonne das Zimmer und ich beobachte lange das Teeglas, den Strahl des einfallenden Sonnenlichts am unteren Rand des Glases, wo die Teeblätter von der Sonne durchflutet werden.“
Währenddessen schlug die Uhr in seinem Wohnzimmer zwölfmal. Traditionell hörte er sich die Schläge an und ließ sie per Telefon den bekannten Professor des Konservatoriums, Lev Aronowitsch Barenboim, hören. Nach dem Tod von Barenboim war ich regelmäßiger und dankbarer „Zuhörer“ der Stundenschläge.
Anschließend gab es Mittagessen, danach einen Mittagsschlaf. Die Übungen am Klavier gingen bis 20.00 Uhr, später aß er zu Abend. Genau um 21.00 Uhr stellte er die Tagesschau „Zeit“ ein, gewöhnliche politische Information, danach las er und ging schlafen.
Ich denke, für einen körperlich alten, aber geistig brillanten Menschen wie Nathan Efimowitsch war diese Lebensweise ein Versuch, die Zeit anzuhalten. Ich überzeugt davon, es gelang ihm. Seine Weisheit, sein freiheitlicher Geist und die Liebe zur Musik halfen ihm dabei.
„Die Wahrheit weiß nicht jener, der vor seine Füße sieht.“
Es gibt noch eine Umgebung in meinem Lebens, wo die Vergangenheit lebendig ist. Die Freundschaft mit der Familie Bibergan bekam ich als „Erbe“ von meinem Vater. Er und Vadim Bibergan waren in einer Klasse. Auf dem Bücherregal in unserer Petersburger Wohnung steht ein Foto: Väter-Schulkameraden mit ihren Söhnen. Alle, jetzt siebzigjährig, außer meinem Vater leben noch. Gott sei Dank! Und alle sind erfolgreich. Auf dem Foto hält Bibergan senior seinen Serjoscha auf den Armen, mit dem ich - wie mit der ganzen Familie von Geburt an sehr eng verbunden bin.
Bibergan ist ein bekannter Komponist, ein starker, markanter, großzügiger Mensch, der mich professionell wie auch menschlich beeinflusste. Nicht zuletzt durch seinen gesunden Konservatismus, seine ruhige Lebensart, seinen respektvollen Umgang mit Menschen, seine Fähigkeit, fremden Schmerz zu spüren, seinen Gerechtigkeitssinn…
Gemeinsam mit seiner Gattin, Lubov Wasiljewna, bewahrt er alte Traditionen. In ihrem Haus entsteht aber auch viel Neues. Dieses warme Haus, „mein“ Haus, behält alles bei, was einst zur Geschichte wird.
„Stillstand der Zeit“ erfolgt auf symbolische Art zum Jahrwechsel.
Die große Tanne, die gewöhnlich bis zur Decke reicht, wird mit altem Christbaumschmuck aus den weit zurückliegenden 30er und 40er Jahren dekoriert und ihre Spitze ziert ein rot leuchtender Papierstern, den Bibergan als Kind eigenhändig gebastelt hat.
Im Haus werden alte private Filme mit einzigartigen Bildern aufbewahrt, Briefe, unter anderem auch das Schreiben vom fünf- bis sechsjährigen Bibergan an den Vater an die Front - der Vater von Vadim Davidowitsch war gemeinsam mit dem legendären Marschall Zhukow in der Armee und einer der Organisatoren von „Lebensweg“ zur Zeit der Leningrader Blockade durch Hitler - Tonbandaufnahmen, seltene Schallplatten, Bücher und vieles andere, was einen Rückblick in die Vergangenheit ermöglicht. Damit gelingt ihnen, die Vergangenheit zur Gegenwart zu machen und nicht nur damit zu leben, was aus Sicht des Formalen aktuell und zweckmäßig ist.
Es gibt erfreulicherweise auch eine andere Vorstellung von „aktuell“ und „zweckmäßig“.
Nicht praktisch und nicht pragmatisch.
Menschlich.
Die Welt organisiert sich, der Mensch sucht Komfort. Das Gesetz der Zweckmäßigkeit, nach dem die moderne Gesellschaft lebt, komprimiert den Raum des sogenannten Unzweckmäßigen.
Der Pragmatismus gewinnt schnell – das Unzweckmäßige leistet geringen Widerstand.
Die Ausgaben für Kultur kürzen? Bitte sehr! Es findet keine Revolution statt. Die Massen weder in Moskau noch in Berlin oder Paris gehen deshalb auf die Straße. Keine Spezialeinheiten, keine Wasserwerfer und keine Reiterstaffeln der Polizei werden benötigt.
Ein elendes Häufchen der zutiefst an der Realisierung ihrer künstlerischen Fantasien Interessierten „quakt“ auf den Zeitungsseiten - das ist alles. Das Fernbleiben von Konzerthallen wird nicht mit Mord und Raub an der Bevölkerung in Zusammenhang gebracht. Darf man das überhaupt in Zusammenhang bringen? Ein kulturfremder Mensch muss nicht zwangsläufig ein Gesetzessünder sein.
Schauen Sie sich die Massen der nichtlesenden und die mit dem Schönen nicht in Berührung kommenden Menschen an. Bei ihnen ist alles großartig, auch ohne das Schöne. Sie haben Häuser, Yachten und Autos... „...und niemand muss Tränen über die Fantasie vergießen“.
Warum auch Tränen vergießen? Man muss das Leben positiv betrachten! Immer nur „cheese“! Eine verbindliche Voraussetzung in der Kommunikation und auf Fotografien… Ich habe mir überlegt, was man über einen Menschen nach seinem Tod sagen kann, wenn es auf allen seinen Fotos nur ein großes „cheese“ gibt?
Ein Leben nach dem Prinzip der Zweckmäßigkeit ist angenehm und sicher. Das „sich kümmern“, zum Beispiel um Obdachlose oder Invalide, ist in dieses Prinzip mit eingeschlossen. Um seine Nächsten muss man sich nicht sorgen – für sie wird schon alles getan: Spezialaufzüge für Rollstühle, Behindertentoiletten und abgeschrägte Gehwege, um bequem die Straße überqueren zu können. Der Staat stellt den Armen soziale Wohnungen zur Verfügung – ist das schlecht?
Es ist nicht schlecht.
Wo aber bleibt die Herzenswärme derer, die lebten und noch leben, die im Stich gelassen werden, aber nicht im Stich lassen. Nur bei denen, die ein angeborenes Talent haben, Mitgefühl zu üben und zu haben. Solche gibt es auch. Aber wenn man kein Talent hat, wo sind die Universitäten, an denen man lernt, fremdes Leid zu spüren?
Deswegen lieben wir unsere ungeregelte Vergangenheit, in der man sich gegenseitig helfen musste.
Denn anders ging und geht es nicht …
Anders geht es nicht
Das Gastspielleben in meinem Land am Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahre änderte seine Form. Es war nicht mehr dem Gesetz der Zentralisierung unterstellt,. Agenten und Organisationen von Kulturprojekten und Kultureinrichtungen luden Künstler ein, an denen sie interessiert waren, und nicht diejenigen, die von der Zentrale angeboten wurden. Ich erlebte noch das alte System der allgemeinen Tarife: Es funktionierte wie ein Vogelring - bist du nicht beringt, kannst du nicht offiziell konzertieren.
Ich erhielt schon als Student von der bekannten Konzertagentur Lenkonzert ein Honorar.
Das erhielt nicht jeder. Als erste Kondition bekam 11 Rubel für ein Konzert, nicht die niedrigste! Mein zweiter und letzter Tarif betrug 14 Rubel.
Danach wurde das „Beringen“ der Künstler abgeschafft, man konnte auf privater Ebene eingeladen werden und das Honorar selbst aushandeln… Während der „Tarifzeit“ war Nathan Efimowitsch einer der am höchstdotierten Pianisten. Er erhielt nicht nur den entsprechenden Tarif, sondern auch eine Prämie für sein künstlerisches Können, eine damals durchaus übliche finanzielle Anerkennung. Die Höhe der Prämie bestimmte die aus Professionellen und Vertretern der Kulturabteilung bestehende Tarifkommission.
Die strukturelle Zentralisierung in unserem Lande betraf auch Gastspiele und Konzerte. Da die Pläne zentral erstellt wurden und nicht immer den Bedingungen entsprachen, unter denen die Künstler auftreten mussten, führten sie zu vielen peinlichen Situationen. In der Stadt Newinnomysk, wo mein Lehrer konzertieren sollte, gab es keinen Flügel. Das Konzert fand nicht statt.
Eines Tages, während einer Gastspielreise schickte man ihn zum Spielen in ein Psychiatrisches Krankenhaus. Dort, und davon war Nathan Efimowitsch überzeugt, waren auch die Ärzte nicht ganz bei Sinnen.
Ein in der ersten Reihe sitzender Patient fragte im Laufe des Spiels: „Wirst du heute auch tanzen?“
Ein anderes Mal musste Nathan Efimowitsch nach Kislowodsk fahren, wo er und zwei weitere erfahrene Pianisten in ein Auto gesetzt und zu verschiedenen Sanatorien gebracht wurden. Am Ort angekommen, wurde Nathan Efimowitsch weder begrüßt, noch erwartet.
Einige Servicekräfte in der Kantine fingen eilig an, Krümel von den Tischtüchern zu fegen. Das Klavier - kein Flügel! - stand im Speiseraum und dort musste der grauhaarige altmodische und sehr berühmte Professor auftreten.
Nach einer spontanen Durchsage im Radio des Kurortes kamen zehn Zuhörer, für die Nathan Efimowitsch spielte, das Spiel mit Kommentaren über die Werke ergänzend.
Anders ging es nicht.
Die Beendigung der tariflichen Bindung versprach den Übergang zum kapitalistischen System für unsere Konzertarbeit. Doch die Hoffnung auf höhere Honorare und bessere Bedingungen für uns Künstler erfüllte sich bei weitem nicht immer. Agenten, Impressarios und Manager, die ihre eigenen Interessen und nicht immer die der Künstler wahrnahmen, wuchsen, Gott weiß woher, wie Pilze aus dem Boden. Es gab auch diejenigen, die versuchten, Gastsolisten einzuladen, um wenigstens irgendeine Konzertaktivität entwickeln zu können.
Eigene Erfahrungen bei Gastspielen in der zweiten Hälfte der 80er und zu Beginn der 90er Jahre prägten sich in mein Gedächtnis ein:
Ich erinnere mich an einen Flug nach Izhewsk. Izhewsk ist die Hauptstadt von Udmurtia. Die Stadt ist der ganzen Welt dank seines berühmten Mitbürgers bekannt: Dort lebt der legendäre Michail Timofejewitsch Kalaschnikow.
Von Izhewsk aus musste man drei Stunden in das kleine, ungefähr hunderttausend Einwohner zählende, Städtchen Glasow fahren, wo am nächsten Tag mein Soloauftritt stattfinden sollte. Nach dem Konzert war eine Fahrt nach Jekaterinburg geplant. Am Flughafen von Izhewsk erwartete mich der Organisator des Konzerts mit seinem Auto. Er war er ein Fahranfänger und sein Auto, ein alter „Moskwitch“ mit einer hässlichen Karosserie, ironisch vom Volk als Absatz bezeichnet, weil er einem umgedrehten Schuhabsatz ähnelte, blieb oft stehen. Da ich zu dieser Zeit noch nicht Auto fahren konnte, musste ich den „Moskwitsch“ anschieben.
Es war Nacht. Das Auto gab mindestens zehnmal „den Geist auf“, und jedes Mal musste ich das Auto wieder anschieben. Unsere Fahrt dauerte nicht wie vorgesehen drei Stunden, sondern acht, weil wir uns während dieser „wunderbaren“ Reise auch noch auf den dunklen Waldstrassen verfahren hatten.
Von Zeit zu Zeit, nachdem ich das Auto wieder angeschoben hatte und der Motor wieder ansprang, musste mein Agent, um den Motor aufzuwärmen, so auf das Gas treten, dass er plötzlich 300 m bis 400 m vor mir in der Finsternis verschwand. Über die Straße rannten Waldtiere. Mir war bange...
In Glasow kamen wir erst um sechs Uhr morgens an. Zu meiner großen Überraschung stellte ich fest, dass ich gemeinsam mit dem ebenfalls angekommenen Freund meines Agenten in einem Zimmer schlafen musste. Und die ganze Nacht öffnete ein großer junger Hund der Gastgeber die Tür mit seinem Kopf, stürzte in das Zimmer, in dem ich schlief, beziehungsweise versuchte zu schlafen, und leckte meine Füße.
Um 10.00 Uhr am Morgen hatte ich schon Probe, um 18.00 Uhr abends spielte ich das Konzert und um 22.00 Uhr fiel ich erleichtert auf die Sitzbank im Coupé des Zuges Richtung Jekaterinburg.
Diese Geschichte, wie auch die nächste, gibt ein Bild vom Gastspielleben der Künstler und vom Umgang mit ihnen zu der sogenannten „Übergangszeit“.
In einem drittklassigen Hotel, fast Wohnheim, in Novosibirsk, brachte man das Klavierduo „Nora Nowik und Raffi Charadzhanjan“, ein hervorragendes Ensemble, das unter Musikkennern sehr bekannt ist, zusammen mit uns in einem engen Zimmer mit zwei Betten an den Wänden unter. Raffi ist auch Buchautor und Präsident der Organisation ANKOL, die sich für nationale Minderheiten in Lettland einsetzt. Damals nahmen wir gemeinsam an einem Klavierduofestival in Novosibirsk teil.
Natürlich war es eine große Schweinerei vonseiten des Veranstalters, uns unter solchen Verhältnissen unterzubringen. Im Zimmer hatten wir eine Toilette, eine Dusche gab es nicht.
Zum Duschen musste man den langen Korridor hinunterlaufen und vorher den Schlüssel beim Zimmermädchen abholen. Die Duschkabinen waren im Duschraum rechts, geradeaus gab es eine Tür.
Ausziehen konnte man sich nur direkt vor der Duschkabine – mehr Platz gab es nicht.
Ausgezogen, um unter die Dusche zu gehen, hörte ich eine heftige Umdrehung eines Schlüssels im Schlüsselloch der Eingangstür.
Die Tür öffnete sich und eine mürrische Frau mit zwei riesigen Tüten in den Händen trat ein. Entschlossen ging sie auf jene Tür, die geradeaus lag, zu. Ich stand neben ihr, so wie Gott mich schuf, und breitete auch noch vor lauter Verlegenheit die Arme aus.
„Madam“, konnte ich gerade noch stottern und erhielt auch gleich eine Antwort: „Anders geht es nicht!“ Sie musste in den Raum hinter der Tür.
Nun, anders geht es nicht! ...
-----------
Mein unaufhörliches Ein- und Auftauchen trug nicht zu meinem seelischen Gleichgewicht bei.
Meine Reisen nach Russland riefen eine sich widersprechende Erregung hervor, und die Rückkehr nach Deutschland, in diese stille ruhige Welt, bremste abrupt das russische Tempo. Ich fühlte mich wie ein Läufer, der nach einem Marathon sofort stehen bleibt: Das innere Tempo wird noch immer vom Tempo des Laufs bestimmt. Das Herz schlägt rasend - im eigentlichen Sinne des Wortes.
Ich raste aber nicht, sondern stand wie eingegraben.
Man sagt, es sei ungesund.
Die Wochen und Monate meiner Russlandaufenthalte knüpften wie selbstverständlich an das Leben vor dem Weggang an. Ich fühlte keine Grenze zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die Verbindung zwischen den Zeiten war nicht gestört. Nur in Deutschland konnte ich immer noch nicht anfangen zu leben. Die Wechsel waren schädlich, nicht nur psychologisch, sondern auch sprachlich.
Nur stückweise begann ich mich in die deutsche Wirklichkeit einzuleben. In Regensburg hatte ich Konzertauftritte, allein und zusammen mit Igor. Bald kamen auch Schüler zu mir. Julia wurde für das Opernhaus ziemlich schnell unentbehrlich. Sie arbeitete bis zu 10 Stunden am Tag.
Der Eintritt eines professionellen russischen Musikers in das System der westeuropäischen Musikausbildung ist mit einer ganzen Reihe von schwierigen Anpassungen und inneren Abstimmungen verknüpft.
Alle, die in der ehemaligen Sowjetunion die Musik zu ihrem Beruf gemacht haben, und auch jene, die nicht diesen Weg gingen, aber an einer Musikschule gelernt haben, erinnern sich an das hohe Niveau der professionellen Anforderungen.
Die sowjetischen Musikschulen haben uns alle in Richtung Professionalität getrieben. Das in Moskauer Behörden entwickelte Programm gab Kindern nicht die geringste Chance, hobbymäßig zu lernen und ohne Verpflichtung einfach nur Freude an der Musik zu empfinden.
Der Druck des Systems führte zu Unwillen am Musizieren, selbst die Lust am privaten Spiel litt darunter. Protest wurde unterbunden, entweder Profi oder – raus!
Dennoch ist es ein sehr leistungsstarkes System für die Erziehung eines Musikers.
Ganz anders sieht die Sache in der „freien Welt“ aus.
Ein Kind darf nicht gezwungen werden. Die Anforderungen des Musikunterrichts werden vom ihm mitbestimmt.
„Die Musikausbildung“ besteht ausschließlich aus dem Unterricht am Instrument - in der UdSSR gab es darüber hinaus ein breites Angebot an theoretischen Fächern. In Deutschland gibt es kein vorgeschriebenes Programm und keine Prüfungen. Wenn man will, kann man „ewig“ lernen, was auch geschieht...
Westliche Musikschulen werden auch von Erwachsenen besucht, die bei Schulkonzerten zusammen mit Kindern auftreten. In diesen Musikschulen werden Zuhörer erzogen, nicht Professionelle. Allerdings gebe ich zu, dass die „Zuhörer“ in der Regel sehr bewandert sind.
Der innere Konflikt mit der Realität vor Ort ist für jemanden, der aus dem „totalitären“ System der sowjetischen musikalischen Bildung kommt, nicht zu vermeiden.
Unvermeidlich ist auch die Reaktion auf die Lawine der pädagogischen Anforderungen. Im Westen sind es oft die Schüler, die darunter leiden. Unverzeihlich wäre es, die eigenen Erfahrungen mit den hiesigen Lehrplänen zu verbinden. Diese Sünde begehen viele Kollegen – ehemalige Mitbürger.
Auch ich wurde anfangs mit den abweichenden Vorstellungen konfrontiert, was aber nie dazu führte, dass meine Schüler harte oder beleidigende Worte von mir hörten - ganz im Unterschied zu vielen meiner „überfleißigen“ Kollegen, die aus dem Osten kommen.
Heute unterrichte ich meistens erwachsene Menschen: meine Studenten und einige, die kompetente individuelle Unterstützung, einen Rat, brauchen.
Was Kinder anbelangt, so versuche ich mit professionell orientierten zu arbeiten, das heißt, mit begabten, die den hohen professionellen Anforderungen standhalten können.
Auch solche gibt es hier.
„Ich, Bürger der Union der Sowjetischen Sozialistischen Republiken, trete ein in die Reihen der Armee, leiste den Eid und schwöre feierlich als Soldat ehrlich, mutig, diszipliniert und wachsam zu sein, streng Kriegs- und staatliche Geheimnisse zu bewahren, widerspruchslos alle militärischen Vorschriften und Befehle des Oberkommandierenden und der Vorgesetzten zu erfüllen. Ich schwöre, verantwortungsvoll das Kriegswesen zu lernen, in vollem Umfang militärisches und ziviles Gut bis zum letzten Atemzug zu schützen, meinem Volk, meiner sowjetischen Heimat und der sowjetischen Regierung treu ergeben zu sein. Ich bin jederzeit bereit, auf Befehl der sowjetischen Regierung meine Heimat zu schützen. Der Union der Sowjetischen Sozialistischen Republiken und als Soldat der Armee schwöre ich, sie tapfer zu verteidigen, gewandt, ehrenvoll und ehrlich und das eigene Blut und das eigene Leben zu geben bis zum vollkommenen Sieg über die Feinde. Wenn ich meinen feierlichen Eid breche, dann soll mich die harte Strafe des Sowjetischen Rechts sowie der Hass und Verachtung des Volkes treffen“
(Text Fahneneid der UdSSR bis 1991)
Auch an mir ging der Kelch nicht vorüber. Nach Abschluss des Konservatoriums stand mir die Armee bevor. In dieser Zeit kannte ich keinen Menschen, der von der Armee träumte, schon gar nicht in meiner Umgebung.
Diesem Los konnte ein gesunder Mann, der weniger als zwei Kinder hatte, praktisch nicht entgehen – das System arbeitete exakt. Für Musiker, die frühzeitig und zuverlässig mit dem Militärorchester verhandelten, war es etwas einfacher. Sie wurden nicht irgendwo hingeschickt, um im fernen Osten wieder „aufzutauchen“. Man verhandelte auch über mich. Mein Schwiegervater rettete mich – er hatte damals die notwendigen Beziehungen.
Trotzdem, hundertprozentig konnte man der Zusage nicht vertrauen.
Am 25. November 1986 musste ich mich um 5.00 Uhr morgens auf dem Kriegskommissariat des Vyborger Bezirks der Stadt Leningrad einfinden. Warum um 5.00 Uhr begreife ich bis heute nicht.
Die Einberufung in die Armee war in der damaligen Zeit eine dramatische Veranstaltung. Von Swerdlowsk kamen meine Mutter und mein Cousin, alle waren angespannt.
Ende November war es winterlich kalt. Damit wir um 5.00 Uhr morgens am genannten Treffpunkt sein konnten, mussten wir um 3.30 Uhr das Haus verlassen. So gingen wir durch den Schnee, durch die kalte windige Leningrader Nacht – Mama, Julia, der Cousin und ich.
Ich kann mich an eine riesige Menge Wehrdiensttauglicher erinnern, unter ihnen war auch ein Mitstudent. Er strahlte Ruhe und die Überzeugung aus, am gleichen Abend zu Hause Kaffee trinken zu können. Sein Vater hätte gute Beziehungen, und deswegen wäre er schon im Militärorchester der Stadt untergebracht. Ich beneidete ihn. Trotz der Beziehungen meines Schwiegervaters war ich meiner Sache nicht sicher.
Später erfuhr ich, dass die Geschichte meines Mitstudenten nicht gut ausging. Anstatt am Abend wieder zu Hause zu sein, wurde er an einen anderen Ort gebracht. Ungefähr nach einem halben Jahr erschien in der Zeitung mit dem patriotischen Namen „Im Dienste der Heimat“ eine Publikation mit einem Foto, auf dem er mit einer „Kalaschnikow“ im Arm den Fahneneid im Norden des Landes ablegte.
Im Kriegskommissariat wurden wir paarweise aufgestellt. Ich gehörte zum ersten Paar. Schwächlich, mit einer „Hahnenkammmütze“, machte ich offensichtlich einen negativen Eindruck auf den kommandierenden Feldwebel. Er sah mich fröhlich an und sagte:
„Na, dein Ende ist gekommen!“
Mein Ende kam nicht. Von der Kaserne in der Stadt Puschkin, wo wir auf den metallischen Netzen der Militärbetten lagen, wurden mein Kamerad Schlagzeuger und ich von dem energisch entschlossenen Feldwebel Ponomarew abgeholt. Am Abend dieses aufregenden Tages fand ich mich im Zentrum der Stadt Leningrad an der Swenigorodskaya Straße wieder, wo in der ehemaligen Kaserne des Semojnowski Regiments der Zaristischen Armee das Stabsorchester des Leningrader Militärrayons untergebracht war.
Den Dienst im Stabsorchester LenWO als vollwertigen Militärdienst zu bezeichnen, wäre nicht korrekt. Selbst die Lage der militärischen Abteilung im Zentrum der großen Stadt erklärte vieles.
Bei uns gab es keinen Kontrollpunkt oder andere militärische Einrichtungen, nicht einmal Waffen. Auf die Straße zu gehen war einfach, man musste nur die Tür öffnen.
Alle Soldaten waren Konservatoriumsabsolventen. Das Orchester gehörte zum Stab. Es war das bekannte Stabsorchester von Leningrad, das Staatsdelegationen begrüßte und direkt dem Chef des Orchesterdienstes des Bezirkes unterstand. Wegen unserer – fast täglich – unbefugten Abwesenheit, unseren Spaziergängen in Zivilkleidung in die Stadt und des freiheitsliebenden Geistes der ehemaligen Musikstudenten, hatten unsere Vorgesetzten ständig Angst vor ihren Übergeordneten. Die Angst unserer Vorgesetzten fiel auf uns zurück. Regelmäßig wurden Razzien durchgeführt, in der Regel kurz vor dem Aufstehen um 6.45 Uhr.
Wer es nicht schaffte, bis zu diesem Zeitpunkt von zu Hause zurückzukehren und im Kasernenbett zu liegen, wurde wegen „unbefugtem Verlassen des Truppenteils oder des Ortes des Militärdienstes“ verurteilt („wegen Fahnenflucht“, jetzt Artikel 337 UK RF) und für einen Monat eingesperrt.
In solchen Fällen wurde eine vollständige Kontrolle der Stuben vorgenommen, und die Zivilkleidung, die von findigen Soldaten illegal versteckt wurde - unter anderem auch in der Büste von Lenin - wurde konfisziert.
In einem Blasorchester ist die Rolle eines Pianisten ziemlich eingeschränkt. Nur wenn ein symphonisches Bühnenprogramm geplant war, konnte ich mich „aufs Ross“ schwingen.
Sie zwangen mich, Tenorhorn zu lernen.
Eigentlich ist es nicht schwer, das Instrument zu beherrschen. In einem Orchester hat es eine eher bescheidene begleitende Funktion. Dennoch war es für mich auf eine besondere Weise anstrengend: Immer, wenn ich das Tenorhorn in die Hand nahm, das Mundstück an die Lippen setzte und anfing, einen scheußlichen Ton herauszupressen, eher Lärm als Ton, schüttelte ich mich derart vor Lachen - auch mit Scham gemischt - dass die Abneigung gegen das vollkommen unschuldige Instrument wuchs, gemeinsam mit dem Unwillen, darauf spielen zu lernen.
Letztendlich ließ man von mir ab. Es gelang mir, einfach „nur“ Pianist zu sein.
Ich spielte auf einem Synthesizer und einem Flügel und trat sogar mit dem Konzert Nr. 3 c-Moll op. 37 für Klavier und Orchester von Ludwig van Beethoven in einer Bearbeitung für Blasorchester auf.
Das war im Haus der Offiziere. Ich spielte in Uniform mit Achselband.
Anschließend, damit ich mich nicht langweilte, wurde ich zum Kommandeur der Abteilung ernannt und zum Sergeant befördert.
Während meiner langen Dienstzeit verfolgte mich jeden Morgen mein Hauptvorgesetzter wegen der unzureichenden Ordnung und Disziplin in den Reihen der mir untergebenen Soldaten.
Mit erlesenen Flüchen und voll Verachtung murmelte er vor sich hin: „Intelligent, sch…“
Abenteuerliche Jahre
Die 80er und 90er Jahre waren abenteuerlich.
Das Abenteuer begann 1982 mit dem Tod von Breschnew und endete am letzten Tag 1999 mit dem Rücktritt von Jelzin.
Das Massensterben unter den Generalsekretären des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (ZKKPSU) in den 80er Jahren erschütterte, aber ermutigte auch die Bevölkerung. Die für unsterblich gehaltenen Mitglieder (kaum zu glauben, ein Mitglied wurde im Jahr 1901 geboren!) erwiesen sich als ganz gewöhnliche Menschen und standen der sterblichen Bevölkerung näher als vermutet.
Nach dem Tod des „Augenbrauenträgers“, wie man Breschnew zärtlich nannte, kam KGB-Chef Andropov an die Macht. Er zeichnete sich durch „die Schaffung einer neuen Ordnung“ aus:
Während der Arbeitszeiten wurde die Passage in Swerdlowsk von beiden Seiten gesperrt und die Bürger durch Kontrolle der Personalpapiere überprüft. Ziel war, die Bummler zu erwischen, die ihre Arbeit schwänzten. Aber Andropov hatte bereits bei seiner Machtübernahme durch Parkinson zitternde Hände, von einer „starken Hand“ konnte also nicht die Rede sein. Er starb bald.
Der Nächste war noch schlimmer. Er musste bei jedem Wort Atem holen, sogar bei den Präpositionen. Der Ärmste!
Man sagte, der darauf folgende hatte ein Lungenemphysem und ein vollkommen ausdrucksloses Gesicht. „Ljonitschka, er ist Ewenk5 !“, sagte Nathan Efimowitsch aufgeregt zu Professor Gakkel. Ich weiß nicht, woher diese Information stammte…
Er hieß Tschernenko – und starb 13 Tage nach der Geburt von Igor im Jahre1984.
Anschließend begann das eigentliche Abenteuer…
Ich erinnere mich, wie sich nach dem Antritt von Gorbatschow plötzlich alles wie durch einen Zauberstab verwandelte und bei uns im Orchester des Stabes LenWo, wo ich zu dieser Zeit meinen Militärdienst ableistete, ein neuer Politoffizier erschien, der uns über die wirklichen Geschehnisse der Oktoberrevolution und die Erstürmung des Winterpalastes aufklärte. Seine Erzählung widerlegte alles, was wir in der Schule gelernt hatten und im Kino sahen.
Wie leicht das System sich wandelte! Wie spannend er genau das Gegenteil von dem erzählte, was er „den Schützern der Heimat“ noch gestern eingeimpft hatte…
Damals kauften wir gierig die Zeitschrift „Ogonjok“, in der uns nach heutigem Maßstab sehr vorsichtig und langsam die Augen für unsere Geschichte geöffnet wurden.
Ich wusste damals dank meines Großvaters und der ausländischen Rundfunkstationen, die sich gegen die Störsender durchsetzen konnten, schon sehr viel darüber. Selbst in den „ideologischsten Jahren“ ging durch unsere noch kindlichen Hände „Selbstverlag / Samsidat“.
Der geschwächte Staat fütterte die Bürger mit politischem Doping, romantischen Kämpfen des Neuen gegen das Alte. Das Land war überzogen mit Kiosken, die Kaugummi und billiges Gesöff mit ausländischen Etiketten verkauften.
Anfang der 90er Jahre, als Leningrad schon in St. Petersburg umbenannt war, gab es in den Regalen unseres Supermarkts in der Zhenja Egorowa Straße nur noch Teigwaren.
Mir ist die Zeitung „Prawda“ vom Mai 1982 heilig, die ich seit dem aufbewahre, mit dem veröffentlichten Referat von Breschnew „Über das Ernährungsprogramm der UdSSR für die Periode bis 1990 und die Maßnahmen zur Realisierung“. Darin heißt es, bis 1990 sollten alle Probleme der Versorgung gelöst werden, und auch die mit den Teigwaren…
Wie soll man das verstehen?
Aus Mangel an Antworten auf aktuelle Fragen entschied sich die Regierung, uns mit einer Show mit dem spektakulären Namen „Putsch“ abzulenken.
Was ihr auch gelang. Wir waren nicht in der Lage, uns vom Fernseher und den ausländischen Rundfunksendern loszureißen.
Es entstand eine riesige Anzahl neuer „Bühnenfiguren“: Helden, Schurken, politische Aktivisten unterschiedlichen Niveaus, ökonomische Reformatoren und so weiter und so weiter... Das war Krimi und Thriller zugleich.
Im Mittelpunkt des Schauspiels fehlten nur noch die beiden Liebenden, die im Stil des amerikanischen Kinos, alle Prüfungen bestehen, zusammen in ihre Heimat gehen und einer glücklichen Zukunft entgegensehen.
Und wie eindrucksvoll war erst die Freigabe der Preise. Das kann man nicht beschreiben!
Damals gesellte sich zu den einsamen Teigwaren auf der Ladentheke ein „breites Sortiment“ von allen, von fast allen benötigten Lebensmitteln. Von dem am Abend zuvor erhaltenen Honorar konnte man aber wieder nur die gleichen Teigwaren kaufen, allerdings zum aktuellen Tagespreis.
Und wie gefällt Ihnen der „zweite Putsch“ mit Chasbulatow und Rutzkoj in der Hauptrolle?
Die aufgewühlte Fantasie zeichnete ein atemberaubendes Bild, auf dem Chasbulatow auf einer Kanonenkugel in seinem Büro umherfliegt. Gleichsam wie Münchhausen...
Und die zweite Wahl von Jelzin! Im Kreml wurde eine Wiedergeburt der „verlorenen“ Kommunisten in Gestalt ihres politischen Anführers erwartet, „Nörgler“, der bis heute unzufrieden ist.
Und die pathetische Geschichte mit dem Bypass, begleitet von der Zeremonie der Übergabe des Atomkoffers an Tschernomyrdin - wer weiß schon, was er in seinem Kopf hatte…
Nur Default 1998 habe ich verpasst. Da waren wir schon in Deutschland.
Und endlich das Finale: die Neujahrsüberraschung 2000 – Jelzins Rücktritt.
Die abenteuerlichen Jahre wurden zur Geschichte.
Jetzt sind wir in einem neuem Genre.
Unsere Städte in Deutschland waren Hannover, Regensburg und Wiesbaden. Hannover war der Beginn. Eine Stadt, in der es so schwer war, so unbehaglich und einsam.
Unvergesslich, unsere Spaziergänge zu Fuß in diesem weitläufigen Raum. Spaziergänge mussten wir machen – erste Schritte in einem Land, in dem wir nicht gemeldet und auf keiner einzigen Liste zu finden waren. Behördengänge waren unumgänglich – wir liefen, um uns in diese Listen eintragen zu lassen. Für die bürokratischen Beamten der Behörden waren wir „taubstumm“, keine Menschen, sondern Nummern
... und sind doch ein Menschen!
Hierin liegt der dramatische Widerspruch der ersten Schritte in einem fremden Land:
Ich erinnere mich, wir spürten unsere Beine schon nicht mehr, als wir uns wieder einmal zu einer Behörde schleppten. Wir kamen genau eine Minute zu spät. Die Mittagspause begann - und wir benötigten nur einen einzigen Stempel!
Ein trockenes „Nein!“ zwang uns zwei Stunden zu warten und zu beobachten, wie der Bürokrat, der uns abwimmelte, im gegenüberliegenden Café im Kreise seiner Kollegen lebhaft erzählte.
In unserem Gram erinnerten wir uns an einen Fall mit Julia in unserem „Wunderland“: Sie musste in einen Vorort von Petersburg zu einem Konzert fahren und wurde dort von mehreren Sängern und einem erwartungsvollen Publikum erwartet. Als sie zum Bahnhof kam, stellte sich heraus, dass der Zug in die benötigte Richtung ausfiel.
Es ist bekanntlich einer der größten Albträume eines Künstlers, nicht zu einer Aufführung erscheinen zu können. Deshalb braucht man ihre Gefühle in diesem Moment nicht zu beschreiben.
Auf die Frage an den Bahnmitarbeiter, ob es eine Alternative zu dem ausgefallenen Zug gäbe, erhielt sie eine negative Antwort.
Julia ging auf den Bahnsteig und fing wie ein Kind zu weinen an. Die Fahrdienstleiterin, die eine schluchzende junge Frau auf dem Bahnsteig sah, ging zu ihr, um zu erfahren, was geschehen sei. Nachdem sie die Dramatik der Situation begriffen hatte, ging sie in Richtung ihres Dienstleiterbüros.
Ein Zug, der normalerweise nicht an dieser Station hielt, bremste auf Wunsch der mitfühlenden Fahrdienstleiterin für eine Sekunde, damit Julia in das Führerhaus des Lokführers aufspringen konnte. Wie sich im Gespräch herausstellte, war der Mann ein Liebhaber klassischer Musik, was sicherlich nicht typisch für Lokführer der Russischen Eisenbahn ist.
Zum Konzert verspätete sie sich nicht!
Die Erfahrungen dieser Jahre zeigen mir, es gibt bei den Deutschen eine eigene Logik für ihre Unnachgiebigkeit.
Die Strukturierung des Alltags rhythmisiert sie. Ich erinnere mich, wie sich Nathan Efimowitsch über das „unrhythmische“ sowjetische Leben beklagte.
Hannover war nicht schuld. Für uns war alles schwer.
Hannover war auch nicht schuld, dass es im letzten Krieg zu 90 Prozent ausgebombt wurde und das Auge eines verwöhnten Petersburgers nur mit wenig attraktiver Architektur, die glücklicherweise der Bombardierung entkommen ist, erfreute.
Und was für ein Wunder, dass Regensburg, nur eine Stunde Fahrt vom ebenfalls bombardierten München entfernt, unzerstört blieb.
Regensburg war unsere zweite Stadt. Hier atmet zweitausend Jahre alte Geschichte. Die Stadt lag uns am Herzen. Und man behandelte uns gut und schrieb gut über uns. Aber unser restliches Leben dort zu verbringen, das konnten wir uns nicht vorstellen – der innere kulturelle Zirkel ist viel zu klein.
Ich weiß nicht warum, aber Wiesbaden gibt einem Luft zum Atmen. Eine wunderschöne „buckelige“ Stadt mit unzähligen russischen Spuren.
Hier ist die „Russisch Orthodoxe Kirche“, mit ihr verbunden eine traurige romantische Geschichte von der Hochzeit und dem frühen Tod der Fürstin Elisabeth Michailowna, der Enkelin von Pavel I. Hier ist das berühmte Kurhaus mit dem Spielkasino, das Dostojewski zum Schreiben seines Romans „Der Spieler“ inspirierte, hier ist der „Strom des Frühlings“ von Turgenjew.
Auf dem Friedhof neben der Orthodoxen Kirche liegen Scheremetews, Woronzow-Daschkows, die Schwester von Küchelbekker und die Tochter von Puschkin Nathalia Alexandrowna… In Wiesbaden lebt auch die Ururenkelin von Puschkin, Clotilde von Rintelen. Hier lebte der berühmte Maler Jawlenskij.
Hier gibt es wunderbare Einheimische, die uns verstehen. Ich bin ihnen ehrlich zugetan.
Drei Städte unserer 10 Jahre in Deutschland – drei unterschiedliche Leben.
Von Rettern und Helfern
Ich denke oft an euch, Retter und Helfer – an mir wirklich teure Menschen.
Aus einer anderen Umgebung mit einer ganz anderen Art zu leben, sehe ich und empfinde eure Taten noch viel stärker als damals. In jenem - heute nicht mehr existierenden - Land gab es immer einen „Platz für Heldentaten“, zu viel Ungerechtigkeit und Gefahr herrschten dort.
Man rettete einander aus Freundschaft, aus Liebe, aus dem schon in den ersten Schulklassen gelernten „Gefühl der bürgerlichen Pflicht“… oder einfach aus Menschlichkeit…
Ich erinnere mich an meine erste Rettung.
Der Retter war der Bruder meines Großvaters, Frontkämpfer, Major und Ordensträger. Er rettete mich aus dem Meer. Ich, damals ein dünner und knochiger Junge, rutschte im Schwarzen Meer durch meinen Schwimmring und ging unter. Ich war fünf oder sechs Jahre alt und kann mich noch gut daran erinnern.
Er zog mich fast bewusstlos heraus.
Später half er mir auch während meiner Studentenjahre - schickte an Feiertagen und zum Geburtstag Geld. Er war ein warmherziger Mensch.
In den Jahren, als mein Vater todkrank war, rettete ihn meine Tante, die Schwester meiner Mutter, damals noch Ärztin an einem Krankenhaus in Swerdlowsk. Sie versorgte meinen Vater mit medizinischer Betreuung.
Die Tante wurde später eine bedeutende Medizinerin und Vorgesetzte in Jekaterinburg und rettete uns alle.
Dank ihr hatten die Großmutter und der Großvater eine etwas längere Lebenszeit.
1984 rettete uns der Schwiegervater vor der Obdachlosigkeit. Damals gelang es ihm, dem Institut, in dem er unterrichtete, eine Dreizimmer Kooperativwohnung für uns zu „entreißen“. Unser Glück war sein Verdienst! Julias Eltern und meine Mutter legten zusammen und kauften uns diese Kooperativwohnung.
Zu Beginn der 90er Jahre, in denen die Kriminalität in unserem Land einen Höhepunkt erreichte, kamen an der Endstation der Bushaltestelle um 1.00 Uhr nachts zwei Gestalten auf mich zu, griffen mich bei den Armen und führten mich - mit einem Messer und einer Pistole bedrohend - irgendwohin.
Wohin und weshalb man mich wegbrachte, weiß ich bis zum heutigen Tag nicht. Aber es war gruselig. Eine Frau, die diese Szene aus ihrem Fenster beobachtete, kam gemeinsam mit ihrer Tochter auf die Straße gerannt, schrie „Sascha, Sascha“, und sagte den Banditen: „Das ist mein Sohn!“.
Eine einfache russische Frau, namens Lidia Petrowna, die im Parterre eines Wohnblocks am Ende der Buslinie lebte, rettete mich.
1990 als die Eltern von Julia, müde vom „Hundeleben“, für immer nach Israel zogen, übernahmen Onkel und Tante von ihr die Betreuung des sechsjährigen Igors. Sie retteten uns aus einer schwierigen Lage. Gute, großzügige Menschen.
In den 90er Jahren wurden wir, Bettler, vom Onkel gefüttert, seine Geschäfte gingen gut und er nahm gerne Teil an unserem Leben.
Und wie viel hat die Mutter meines Halbbruders väterlicherseits für Igor getan. Sie hat ihm vermittelt, Petersburg so zu lieben, dass er auch heute noch, nach zehn Jahren in einer anderen Umgebung, in seinem Herzen dieser Stadt treu geblieben ist.
Und Freunde halfen an den schweren Sterbetagen meines Lehrers.
In Deutschland konnte ich mich an die Schultern der Familie Schick anlehnen.
Und ein guter Mensch spendete, „einfach so“, Geld für unser Festival in Petersburg.
Und liebe Freundin Ingrid Freiberg hat mir großzügig bei der Arbeit an diesem Buch geholfen.
Ich werde es nicht vergessen.
Möge Gott euch beschützen.
Alle, die helfen.
√úber die Mutter
Meine Mutter hat kein „Zuhause“. Bürokratisch gesehen schon: Sie wohnt jetzt in Hannover.
Für sie ist es einfach, sich loszureißen und irgendwohin zu fliegen, um irgendjemandem zu helfen, jemanden zu retten.
Wir sind jetzt viel näher beieinander.
Von Wiesbaden bis Hannover sind es ungefähr 400 km – verglichen mit 2.000 km zwischen Petersburg und Jekaterinburg eine vergleichsweise kurze Strecke.
Doch wir sehen uns kaum. Zurzeit ist ihr „Projekt“ der kleine Enkel, der Sohn einer meiner Schwestern, dem meine Mutter ihr heutiges Leben widmet. Sie ist überall, wo er ist. Meine Mutter ist ein freier Mensch. Sie ist wirklich frei, weil sie sich selbst die Freiheit schenkt. Sie ist „ihr Zuhause“. Und dieses „Zuhause“ kann sie an jeden beliebigen Ort auf der Welt versetzen, solange man dort frei atmen kann. Das ist für sie das einzige Kriterium für eine äußerliche Abhängigkeit, das sie zulässt
Ein Haus, unbewegliches Vermögen, ist für sie ein Thema von geringem Interesse - auch andere Besitztümer locken sie nicht. Sie macht teure Geschenke von ihrem „letzten Geld“, das bringt ihr mehr Zufriedenheit, als wenn sie etwas für sich kaufen würde.
Als denkender Mensch und als Wissenschaftlerin macht sie sich Gedanken über das Leben und ist immer voll neuer Ideen.
Vielen erscheint ihre Art zu leben kurzsichtig, mir aber erscheint es kurzsichtig und naiv, eine solche Bewertung abzugeben:
Im Unterschied zu vielen langfristig Denkenden und Umsichtigen kennt meine Mutter den Wert des Lebens, spürt seinen Sinn und seine Vergänglichkeit.
Sie lebt!
---------
„Wie wäre es interessant, eine Zeitlang in einer weniger interessanten Zeit zu leben ...“
(Nathan Perelman)
Es wäre unhöflich, den Leser nicht über das sich nahende Ende der Erzählung zu unterrichten. So wie im Flugzeug, wo eine halbe Stunde vor der Landung über den Sinkflug informiert wird.
Könnte ich doch alles wie im Kino oder bei einem Magnetband zurückspulen und alles aufs Neue sehen... endlich die verführerische Form des Konjunktivs, dem wir uns so gerne hingeben, mit seinem „ob“ und „wenn“ verstehen...
Wie wäre es schön, wenn es so funktionieren würde: „Dort, wo du geboren bist, dort braucht man dich!“, wenn das pulsierende Leben auf immer bleiben würde... und alle wären am Leben - und zusammen. Und blieben dort, wo sie geboren wurden, und lebten gemeinsam miteinander.
Ich wäre nicht ausgerissen aus der für Künstler stickigen Atmosphäre von Swerdlowsk nach Petersburg, und Jura und Lena hätte es nicht nach Moskau vertrieben. Und unser Leben wäre nicht durch die Machtwechsel gesprengt worden, wir wären nicht wie zerstreute Scherben herumgeflogen, um Gott weiß wie weit von unserem Ausgangspunkt entfernt zu landen.
Ich hätte weder das Lager, noch Frau N. gesehen, kein Deutsch und kein Auto fahren gelernt, hätte nicht erlebt, was ich erlebte, und nicht geschrieben, was ich hier schrieb.
Es hätte keinen Aufenthalt in „meinem“ Petersburg gegeben, keine glücklichen zwanzig Jahre mit meinem Lehrer, keine…
Mich schaudert, das weiter fortzusetzen! Zu denken, dass mit irgendetwas für irgendetwas gebüßt wird – das wäre zu schrecklich. Das will ich nicht! Zum Teufel mit ihm, dem Konjunktiv!
Deutschland ist ein sonniges Land. Ein bequemes und ruhiges Land.
Das Land der Lächelnden. Ein Land, das wie ein hartes Korsett mit Vorschriften und Gesetzen streng zugeschnürt ist, und deswegen so eine wunderbare Haltung besitzt. Jede beliebige alltägliche Handlung wird von einer Unmenge an gesetzlichen Paragraphen geregelt und findet ihre Umsetzung direkt im praktischen Leben.
Vor zehn Jahren aus einem Land, wo meist nur ein „Handschlag“ genügt, angekommen, gerieten wir in ein Land der Gesetze und der Regeln. Ohne das „Gen der Gesetzestreue“ im Blut zu haben spürten wir Unbehagen bei verschiedenen Anlässen, setzten uns mit der neuen Realität auseinander, bestanden auf Menschlichkeit, beim Versuch über Sachverhalte zu diskutieren, die ein für alle Mal nicht zur Debatte standen.
Jede bürokratische Ablehnung wurde wie ein „persönlicher Angriff“ aufgenommen. Jeder amtliche Brief, in dem auf einem vorgefertigten Formblatt unser Familienname stand, wurde von uns wie ein persönliches Schreiben gewertet. Gerade so, als ob in in den Behörden heimtückische Angestellte säßen, um eine Verschwörung gegen uns vorzubereiten.
Das Verständnis dafür, dass der Staat mit seinen Bürgern nicht persönlich kommuniziert und auch keine persönlichen Beziehungen aufbaut, seien sie gut oder schlecht, kam nicht sofort.
Mit dem hervorragend funktionierenden Apparat über die Themen „kann man“ und „darf man nicht“ zu diskutieren, ergab genauso wenig Sinn, wie damals in den 80er Jahren, als wir versuchten, mittels eines sowjetischen Gesetzes eine Registrierung für Busjas „Federkasten“ zu bekommen.
Wie konnte es auch anders sein … in der Heimat, in den sowjetischen Jahren, erlebten wir von Kindheit an das genaue Gegenteil. Eine Straftat wurde vom Kollektiv verurteilt, von den Pionieren, dem Komitee der Komsomol, der Parteiversammlung... wo ein Vertreter der Macht nicht nur Strafen verhängte, sondern auch tadelte: „Wer hat Sie erzogen, wohin schaut die Öffentlichkeit?“
Schon Tadel bedeutete, dass man sich verändern musste, um ein „vernünftiger“ Staatsbürger zu werden.
Die westeuropäische Gesellschaft erzieht niemanden um, verdammt niemanden, verzeiht niemandem.
Sie fördert materiell und straft materiell. Das ist praktisch.
So lebt das sonnige Deutschland. Es rast mit komfortablen Zügen, fliegt über Autobahnen fast ohne Geschwindigkeitsbeschränkung und in den kleinen gemütlichen Dörfchen verstreichen in aller Stille langsam die Tage.
Das Finale
So viele Menschen gibt es auf dieser Welt, die leicht und voller Freude auf andere zugehen… Manchmal bin ich neidisch auf ihre Mitteilsamkeit, ihre Offenheit.
Neidisch, dass für sie eine kritische Einstellung keinen Vorrang in ihren Beziehungen zu ihrer Umgebung hat. Dabei werden sie von einer riesigen Menge unterschiedlicher Menschen umgeben, die immer lächeln, bereit, ohne Unterbrechung zu feiern, spontan auf Reisen zu gehen, täglich per Telefon miteinander zu sprechen …
Schon mein ganzes Leben habe ich Schwierigkeiten, Leute offen anzunehmen, sie hereinzulassen in mein Leben und in meine Seele. Wenn ich in eine gutgelaunte Gesellschaft gerate, die mit großem Vergnügen über das Wetter spricht, über die Angewohnheiten ihrer Hunde und Katzen, Vorfälle beim Fischen und ihre fantastische Karriere, spüre ich, wie sich meine Mundwinkel senken, ich bin nicht fähig, einen Satz zu bilden, ich verwelke vor den Augen der anderen, wobei ich den Eindruck eines menschenscheuen, viel schlimmer noch, eines hochmütigen Menschen hinterlassen kann, der nicht über Nichtigkeiten sprechen will. Das entspricht aber nicht der Wahrheit. Zu den Intellektuellen habe ich mich nie gezählt und zähle mich bis heute nicht dazu. Auch über Hunde bin ich gerne bereit zu sprechen, aber das Gespräch muss Farbe haben. Es liegt nicht daran, worüber man spricht, sondern wie! Einer fantasielosen langweiligen Information ziehe ich immer eine lebhafte Interpretation der Ereignisse vor. Dafür bin ich manchmal auch bereit, Tatsachen zu vernachlässigen.
Ehrlich!
In frühester Jugend sagte mir meine Mutter: „Leute muss man mit Eigennutz wahrnehmen. Das heißt, in jedem Menschen, den du auf deinem Weg triffst, musst du etwas Wertvolles für dich finden, etwas, was dich bereichert, berührt oder aufregt...
Das muss nicht unbedingt ein hoher Intellekt, das können auch andere menschliche Talente sein. Eine Freundschaft zu pflegen ist schon ein Talent.“
Leider kann ich nicht mit allen Freundschaft schließen. Und ich wollte es auch nie. Und es tut mir auch nicht wirklich leid.
Aber ich wollte und will Freundschaft mit denen schließen, die mir „ausgewaschen wie Gold aus dem Sand“ entgegenstrahlen, und die mir trotz meiner Unfähigkeit, mit jedem Beliebigen zusammen sein zu können, erhalten bleiben - vielleicht sogar gerade deshalb...
„Haben Sie schon russische Freunde gefunden?“ Diese Frage wurde uns oft gestellt, vor allem zu Beginn unseres Aufenthaltes in Deutschland. Gezielt suche ich aber weder Russen noch andere, weil ich kein Bedürfnis habe, bei einem Menschen oder in einer Gesellschaft Zuflucht zu finden. Noch weniger unterscheide ich nach nationaler Zugehörigkeit – ist auch nicht von Interesse. Aber ich weiß auch, dass das Schicksal kostbare Geschenke macht. Ich habe sie erhalten. Ich hüte sie liebevoll. Ich bin glücklich, dass ich euch habe, meine Teuren. Euch, die ich an den Fingern abzählen kann. Ihr, meine Angehörigen, und Ihr, meine Freunde.
Zusammen machen wir einen Flug von Punkt „A“ nach Punkt „B“.
Möge Gott, dass wir nicht so bald landen!
ANHANG
1. G.A. Towstonogow (1915 – 1989) – einer der größten russischen Regisseure, Chef- Regisseur des berühmten Bolschoji-Schauspielhauses in Leningrad (St. Petersburg)
- Babusja, (Babuschka) – Oma
- I.A.Iljin (1883 – 1954) - russischer Philosoph, Schriftsteller und Publizist
- „Häschen“ (Saitschiki) – weißrussische Rubel
- Ewenk, Ewenken – kleines Volk in Sibirien, wirtschaftlich unterentwickelt;
traditionelle Wirtschaftszweige der Ewenken sind Rentierzucht, Fischerei und Pelzjagd
6. Diese Hinterhöfe sind so eng wie Brunnenschächte
Über den Autor
Die internationale Presse feiert Palmov geradezu √ľberschw√§nglich: ?gl√§nzender Interpret der modernen Musik, gro√üe Virtuosit√§t, √§u√üerste Differenzierung der auf dem Klavier √ľberhaupt m√∂glichen Klangfarben, Pianissimo - Magie und urw√ľchsige Kraft, ein ungemein wendiger, konturbewusster und klangversierter Pianist? lauten die Charakterisierungen seines Klavierspiels.