Kurzgeschichte
Die Stadt der Kerzen
Kategorie Kurzgeschichte
© Umschlag Bildmaterial: vic&dd - Fotolia.com
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
Ich erinnere mich noch gerne meiner allerersten Zeilen - ein Schulgedicht: Der Winter ist ein Bösewicht, die Bäume tragen Schneegewicht, die Stämme sind kahl und so schwarz wie ein Pfahl, die Felder sind weiß und auf dem See liegt Eis. In den seither vergangenen Jahrzehnten hat sich mein Schreibstil sicher geändert - ist erwachsen geworden -, aber die Freude am Schreiben ist ungetrübt.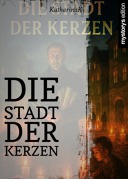
Die Stadt der Kerzen
Die Stadt der Kerzen
Es war eine Stadt, die nie ganz dunkel wurde. Seit Menschengedenken stellten ihre Bewohner Kerzen in die Fenster, auf die Treppen, in die Nischen der Straßen. Jedes Haus hatte seinen eigenen Duft, seine eigene Flamme. Manche Kerzen flackerten nervös, andere brannten ruhig und stetig, als wüssten sie etwas über Geduld, was den Menschen entging. Und so lebten sie – im warmen Zittern dieses Lichtmeeres, das keine Sonne brauchte, um zu leuchten. Doch eines Tages kam ein Mann. Er kam nicht in der Nacht, wie man es von
Unheil gewohnt ist, sondern im grellen Vormittag. Er trug glänzende Pläne in der Hand, Bündel aus Papier und Versprechen. Seine Worte klangen wie Glas, durchsichtig, klar und unantastbar. „Ich bringe euch mehr Licht“, sagte er. „Euer Leuchten ist schön, doch ungeordnet. Lasst mich die Flammen bändigen – ich sorge für Gleichmaß, für Helligkeit, die den ganzen Tag über bleibt.“ Seine Hände rochen nach Wachs und Eisen. Er sprach von Fortschritt, von einer Zukunft, die nicht mehr rußen würde. Die Menschen hörten zu. Sie sahen, wie seine Augen funkelten – wie
das Licht einer Flamme, die nichts verbrennt, nur spiegelt. Zuerst bat er um ein paar Dochte. „Ich kürze sie nur“, sagte er, „damit die Flamme gleichmäßig brennt.“ Er zeigte, wie zu lange Dochte flackerten, wie sie Schatten warfen, die sich gegenseitig verschlangen. Und ja – als er sie kürzte, wurde das Licht ruhiger, gleichmäßiger. Die Menschen nickten. Manche klatschten. Doch bald schnitt er mehr als nur Dochte. Er begann, das Wachs zu teilen. Nicht willkürlich – so sagte er – sondern
gerecht. Die Reichen bekamen große Vorräte, damit sie „die Stadt repräsentieren“ konnten. Den Armen nahm er ein wenig ab – „nur vorübergehend“, um die Ordnung zu sichern. Aber was ist „vorübergehend“ in einer Stadt, die sich an Dunkelheit zu gewöhnen beginnt? Die Straßen der Zweifler verloren zuerst ihre Kerzen. Der Mann nannte sie ineffizient, unruhig, zu widersprüchlich. In manchen Gassen erloschen die Flammen ganz. Dort roch es nach kaltem Wachs und resigniertem Atem.
„Ihr braucht mein Feuer“, sagte der Mann, „ich teile es euch zu, wenn ihr mir folgt.“ Und während er sprach, zitterten die Schatten hinter ihm – lang, scharfkantig, als gehörten sie zu etwas Größerem als einem Menschen. Er nannte seine Arbeit bald *Ordnung*. Dann *Effizienz*. Schließlich *Wiederherstellung.* Die Menschen nickten immer noch – einige aus Furcht, andere aus Gewohnheit. Sie wussten nicht, wann das Flackern, das sie einst liebten, zur Unruhe erklärt worden war.
Nur wenige flüsterten: „Er macht uns abhängig von seinem Feuer.“ Doch ihre Stimmen gingen unter in der gleichmäßigen Helligkeit, die keine Abweichung mehr duldete. Eines Abends, als der Wind durch die Straßen strich, begann die Stadt zu frieren. Die Flammen brannten noch, doch sie wärmten nicht mehr. Es war ein Licht ohne Herz, ein Glanz ohne Leben – kalt wie die Oberfläche eines Spiegels. Der Mann sprach von neuen Regeln, von einem Uhrwerk, das den Takt der Flammen bestimme. Jede Kerze musste nun zur selben Stunde brennen, im selben
Maß, unter denselben Bedingungen. „Das ist Fortschritt“, sagte er. „Das ist der *Plan*.“ Doch der Plan war kein Licht – er war ein Umbau der Seele. Er veränderte die Stadt nicht durch Feuer, sondern durch das, was er ihm nahm: den Willen, selbst zu leuchten. Menschen, die einst Kerzen gegossen hatten, saßen nun an Tischen aus grauem Metall. Sie erhielten Wachsrationen, deren Menge sich nach Gehorsam richtete. Kinder lernten, dass das freie Flackern gefährlich sei. Alte erzählten leise von
einer Zeit, in der Kerzen noch Namen trugen, in der man die Flamme eines Freundes aus der Ferne erkannte. Doch niemand wagte mehr, das eigene Licht zu schützen. Nur eine Frau – eine, die früher in der Gasse der Erzählerinnen gewohnt hatte – wagte, ein Stück alten Docht hervorzuholen. Sie tauchte ihn in den letzten Rest ihres Wachses, das sie in einem zerbrochenen Krug versteckt hatte. Als sie die Flamme entzündete, flackerte sie wild, ungezähmt – ein kleiner Aufstand gegen das große Gleichmaß.
Sie stellte die Kerze auf ihr Fensterbrett. Ein Kind sah sie. Dann ein Nachbar. Und bald flackerten hier und dort wieder vereinzelte Lichter – unsauber, unregelmäßig, voller Leben. Der Mann kam mit seinen Scheren, um sie zu kürzen. Doch jedes Mal, wenn er eine Flamme löschte, entzündeten sich zwei neue. Nicht, weil jemand sie absichtlich anzündete, sondern weil das Wachs, das er glaubte zu besitzen, immer noch den Geruch der Freiheit trug. Er befahl, das Licht zu kontrollieren. Er drohte, er predigte, er versprach –
doch das Flackern ließ sich nicht vermessen. Es wanderte über Mauern, über Grenzen, über Herzen. Schließlich stand er auf dem Marktplatz, umgeben von Kerzen, die er nicht mehr zählen konnte. Das Licht war so unregelmäßig, dass er keine Schatten mehr erkennen konnte – und vielleicht war das das Schrecklichste für ihn: zu wissen, dass ein Mensch ohne Schatten kein Mensch mehr ist, sondern nur eine Figur aus Glas. Da ließ er seine Scheren fallen.
Man sagt, sie rosteten dort, wo sie lagen, im Wachsmeer der zurückeroberten
Stadt. Die Menschen lernten wieder, Kerzen selbst zu gießen. Nicht alle gleich, nicht alle schön – manche schief, manche triefend vor zu viel Eifer. Aber sie brannten. Und sie wärmten. Die Stadt glühte wieder, unordentlich und lebendig. Und irgendwo in einer Gasse sagte jemand: „Wir dachten, wir hätten das Licht verloren. Dabei mussten wir nur erinnern, dass es von uns kommt.“ Seitdem feiern die Menschen jedes Jahr das *Fest der ersten Flamme*. Sie
entzünden Kerzen aus altem Wachs, lassen sie unterschiedlich hoch abbrennen und erzählen sich Geschichten über den Mann mit den Scheren – nicht als Mahnung, sondern als Erinnerung:
dass jedes Licht, das alle gleich machen will, am Ende selbst erlischt.
Und in der Mitte des Platzes steht eine Statue aus Bronze – keine Heldin, kein Held, sondern eine schlichte Hand, die eine kleine Flamme hält.
Darunter steht in die Platte graviert:
*„Licht ist kein Besitz. Es ist Vertrauen.“*
Über den Autor
Der Winter ist ein Bösewicht,
die Bäume tragen Schneegewicht,
die Stämme sind kahl
und so schwarz wie ein Pfahl,
die Felder sind weiß
und auf dem See liegt Eis.
In den seither vergangenen Jahrzehnten hat sich mein Schreibstil sicher geändert - ist erwachsen geworden -, aber die Freude am Schreiben ist ungetrübt.
Leser-Statistik
4
Kommentare
Kommentar schreiben
| PamolaGrey Wow, das geht ans Herz, wirklich sehr gut geschrieben. LG Pam |