Romane & Erzählungen
the darkness inside me - Kapitel 1
Kategorie Romane & Erzählungen
© Umschlag Bildmaterial: Spiber - Fotolia.com
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
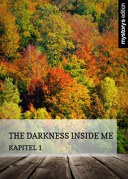
the darkness inside me - Kapitel 1
Kapitel 1 Alles war ruhig. Wie immer um diese Zeit. Mama und Papa arbeiteten normalerweise noch. Und die kleinen waren beide in der Schule. Einen Moment war es, als w├Ąhre alles normal. Die Katze begr├╝├čte mich mit einem Schnurren, ehe sie die Treppe hoch verschwand. Aus dem Wohnzimmer konnte man das leise Ticken der Uhr h├Âren. Im Badezimmer tropfte die Dusche. Es war, als w├╝rden die anderen jeden Moment reinkommen. Doch so einfach war das nicht. So einfach w├╝rde es nie wieder sein. Augenblicklich schossen mir wieder Tr├Ąnen in die
Augen. Diese verdammten Tr├Ąnen. Man sollte meinen, dass meine Augen irgendwann austrockneten, aber sie kamen immer und immer wieder. Mein Blick verschwamm und halb blind stellte ich meine Handtasche und die Schl├╝ssel auf dem Siedebord im Flur ab, ehe ich ins Badezimmer wankte und dabei beinahe ├╝ber einen Berg W├Ąsche stolperte, den Mum dort heute Morgen wohl liegen hat lassen. Das war so typisch f├╝r sie. Immer alles vorbereiten, damit sie nach der Arbeit nicht mehr so viel zu tun hatte. Vielleicht sollte ichÔÇŽ wie in Trance wischte ich mir die Tr├Ąnen aus den Augen und drehte mich zur Waschmaschine um. Arbeit. Das w├╝rde
helfen. Hoffentlich. Schniefend hockte ich mich vor der Maschine auf den Boden und begann die nasse W├Ąsche aus der runden ├ľffnung zu ziehen. Auf der Maschine stand noch ein W├Ąschekorb, der kurzerhand von mir runtergezogen wurde und mit lautem Scheppern auf dem Boden landete, ehe ich die feuchten Sachen hochhob und in den Korb dr├╝ckte. Schritt Nummer eins war damit erledigt. Nun die Schmutzw├Ąsche. Einen Moment sah ich mich etwas verloren im Bad um, ehe ich mich mit einem Ruck vorlehnte und den W├Ąscheberg zu mir heranzog. Haupts├Ąchlich Kinderw├Ąsche, aber hie und da blitzte ein Shirt meines Vaters
auf, oder ein H├Âschen meiner Mum. Schnell dr├╝ckte ich das ganze B├╝ndel in die Maschine. Blo├č nicht an die beiden denken. Einfach weitermachen. T├╝r zu. Aufstehen. Waschmittel aus dem Eimer und rein in die Lade. Lade zudr├╝cken. Programmwahl. Start dr├╝cken. Und das wars dann. Das Ger├Ąt begann seine Arbeit. Das Wasser wurde angepumpt, die Maschine begann sich langsam zu bewegen. Abwesend legte ich meine Hand auf die raue Oberfl├Ąche. Das R├╝tteln der Waschmaschine war beruhigend. Ich schloss einen Moment meine Augen und verbannte alles andere aus meinen Gedanken, konzentrierte mich nur auf das Gef├╝hl der Vibrationen
unter meinen Fingern. Und ich w├╝nschte mir, dass dieser Moment ewig sein k├Ânnte. Dass ich einfach f├╝r immer hier stehen k├Ânnte. Das die Zeit nicht mehr vergehen w├╝rde und ich niemals das Tun m├╝sste, was von mir erwartet wurde, sobald die Haust├╝r das n├Ąchste Mal aufschwang. Wie sollte ich das schaffen? Wie sollte ich das alles schaffen? Verzweifelt riss ich meine Augen wieder auf und starrte an die Wand mir gegen├╝ber. Verdammte schei├če! Wie zur H├Âlle sollte ich das machen? Wie zur H├Âlle sollte ich f├╝r zwei Kinder sorgen? Ich hatte doch keine Ahnung von Kindererziehung! Oder davon eine Familie zu leiten! Verdammt, verdammt,
verdammt! Ein Schrei dr├Ąngte sich meine Kehle hoch und ehe ich mich zur├╝ckhalten konnte br├╝llte ich alles heraus. Die Trauer, die Wut, die Verzweiflung, die bodenlose und abgrundtief schwarze Angst. Einfach alles. Wie wild trommelte ich gegen die Wand, schlug mit meinen F├Ąusten auf den Putz ein und schrie und schrie, bis ich meine Stimme hei├čer und meine F├Ąuste rot waren. Hektisch atmend wischte ich mir die verschwitzten Haare aus dem Gesicht und stand noch einen Moment still da, die H├Ąnde an den Kopf gedr├╝ckt, der Blick verst├Ârt, die Lippen zitternd. Ich durfte nicht den Verstand verlieren. Nicht jetzt. Die M├Ądchen brauchten
mich. Die M├Ądchen. Sie waren noch so jung. W├╝rden sie es verstehen? Ich konnte es nur hoffen. Und zugleich hatte ich Angst davor. Marie war erst acht. Elisabeth erst sechs. In diesem Alter sollte man so etwas noch nicht lernen m├╝ssen. Man sollte noch nicht wissen d├╝rfen, wie es sich anf├╝hlte. Dieses Loch kennen, dass sich w├╝tend und zerst├Ârerisch durch dein Herz fra├č, w├Ąhrend es deine Gedanken lahmlegte und deine Seele verdampfte. Sie sollten eine frohe Kindheit haben. Beh├╝tet, einfach, gl├╝cklich. Mit ihrer Mutter, die sie ├╝ber alles liebte. Mit ihrem Vater, der ihnen immer die Tollsten Dinge zeigte. Sie sollten lachen,
leben, Freude haben. All das w├╝rde ich ihnen heute stehlen. All das w├╝rde ich ihnen mit ein paar simplen Worten entrei├čen. Sie ├╝ber den Abgrund sto├čen, wissend, dass am Grund nichts als Verzweiflung und Zerst├Ârung warteten, wenn ich es nicht schaffte, sie vorher aufzufangen. Und ich wusste nicht, wie ich das schaffen sollte. Wie sollte ich ihren Sturz bremsen? Wie sollte ich sie abfangen, ehe sie am Boden aufschlugen und alles Licht aus ihren Seelen gesaugt wurde? Schluchzend lie├č ich meine H├Ąnde sinken und schlurfte aus dem Badezimmer, ehe ich unschl├╝ssig im Flur stehen blieb. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit mir
anfangen sollte. Ich musste etwas tun. Mich irgendwie ablenken. Aber wie? Wie sollte ich es schaffen, meine zerst├Ârerischen Gedanken zu ertr├Ąnken, w├Ąhrend sie auf mein Herz eintrommelten und meine Seele zu ersticken drohten? Unsicher ging ich weiter ins Wohnzimmer, sammelte dort die Spielsachen auf, die vereinzelnd auf dem Boden lagen, bevor ich sie einfach in eine Schublade der Wohnwand stopfte. Ich hatte keine Ahnung, wie Mama inzwischen alles Ordnete. Oder geordnet hatte. Aber dar├╝ber w├╝rde ich mir sp├Ąter Gedanken machen. F├╝rs erste machte ich einfach stumpf weiter, versuchte nichts
zu f├╝hlen. Einfach Garnichts. Das war besser als dieser Ewige, verdammte Schmerz. Auf dem Wohnzimmertisch standen noch die Teller ihres Fr├╝hst├╝cks. Ich stellte alles zusammen und brachte es in die K├╝che, wo sich das schmutzige Geschirr stapelte. Seufzend stellte ich die Teller in die Sp├╝le und ├Âffnete die Maschine, in der das saubere Geschirr darauf wartete, ausger├Ąumt zu werden. Ich wollte Ablenkung. Da hatte ich sie nun. Teil f├╝r Teil r├Ąumte ich die Teller aus, das Besteck in die Schublade, die Pfannen in den Schrank, bis ich schlie├člich bei den Gl├Ąsern ankam. Bunt gemischt stapelten sich die schlichten, durchsichtigen
Gl├Ąser mit den bunten Wasserflaschen der M├Ądchen neben den bunten Coca-Cola Gl├Ąsern, die es immer bei McDonalds gab und den verschiedensten Gl├Ąsern mit Aufdrucken irgendwelcher Cartooncharakteren. Und mitendrinnen stand ein gro├čer Krug. Eines dieser Gl├Ąser mit Henkeln, in dem man in den Bierzelten das Bier ausgeschenkt bekam. Das Ding war Papa immer heilig gewesen. Niemand sonst durfte es verwenden. Da war er unbestechlich gewesen. Einmal dachte er, dass es jemandem hinuntergefallen und zerbrochen war und w├Ąhre deswegen beinahe an die Decke gegangen. Abwesend nahm ich das bereits
angeschlagene Glas und drehte es in meinen H├Ąnden, w├Ąhrend vor meinem inneren Auge Bilder meines Vaters auftauchten, wie er auf dem Sofa sa├č, ├╝ber irgendetwas lachend, dass er gesagt hatte, w├Ąhrend Marie und Elisabeth auf dem Teppich miteinander rangelten und meine Mutter ihn tadelnd angesehen hatte. Ich hatte mit verschr├Ąnkten Armen an der T├╝r gelehnt, schon halb im Aufbruch und ihn b├Âse angestarrt, sauer ├╝ber einen seiner Typischen Witze, die meist sehr unter der G├╝rtellinie waren. Meistens waren es Nichtigkeiten. Bl├Âdsinn. Nichts weiter als kleine Sticheleien. Aber sie taten verdammt weh.
Schon seltsam. Wie nichtig solche Kleinigkeiten pl├Âtzlich wurden, wenn man sich das gro├če Ganze ansah. Ja er hatte seine Fehler, seine Schw├Ąchen und war oft ein Arsch gewesen. Aber im GrundeÔÇŽ er war doch mein Vater. Und nun? Ja, was nun? Nun war er es nicht mehr. Nur noch Schall und Rauch. Obwohl ich immer noch ├╝berall seine Pr├Ąsenz f├╝hlen konnte. Er war immer noch hier. In jedem Raum dieses Hauses, dass er mit eigenen H├Ąnden erbaut hatte. Er war in jedem M├Âbelst├╝ck, in jedem kleinen Dekoartikel, in der Luft, die er t├Ąglich geatmet hatte, die ich nun mit jedem Luftholen einatmete. Er war hier.
Ebenso wie sie es war. Sie beide waren hier. Und zugleich waren sie es nicht. W├╝rden es nie wieder sein. Einem Impuls folgend hob ich den Krug und lie├č ihn mit einem Schrei auf den Boden krachen. Das Glas traf auf dem Boden auf und zerbrach in hunderte Teile und zugleich zerbrach auch etwas in mir; lie├č mich auf die Knie fallen, schluchzend, flehend, w├Ąhrend ich, halb blind durch die Tr├Ąnen, die ungehindert ├╝ber meine Wangen rannen versuchte die Scherben irgendwie zusammenzuschieben. Die scharfen Kanten des zerbrochenen Glases schnitten scharf in meine Hand, doch der Schmerz machte mir nichts aus.
Ich begr├╝├čte ihn wie einen alten Freund. Ich verdiente den Schmerz. Er geh├Ârte zu mir. Von nun an, bis in alle Zeit w├╝rde er ein Teil von mir sein. Ich grub meine H├Ąnde einfach weiterhin in die Scherben, versuchte r├╝ckg├Ąngig zu machen, was ich gerade getan hatte. Doch das konnte ich nicht. Niemand konnte das. Nichts konnte das Glas wieder ganz machen. Nichts konnte es wieder zur├╝ckbringen. Nichts konnte sie jemals wieder zur├╝ckbringen. Sie waren fort, w├╝rden nie wieder kommen. Sie hatten mich alleine gelassen. Sie hatten uns alleine gelassen und w├Ąhrend sie gegangen waren, war ein Teil mit ihnen gestorben. Ein Teil, der nun zerbrochen
zwischen all den Scherben lag, w├Ąhrend der Rest von mir langsam von Rissen durchzogen wurde, gesch├╝ttelt wurde, gepeinigt, von Leid, von Angst, von Unverst├Ąndnis. Ein Halber Mensch. Alles was mir jetzt noch blieb war der Schmerz, die Gewissheit, dass nichts je wieder sein w├╝rde wie es war. Alles was blieb, war die Einsamkeit. Alles was blieb, war die ewig schwarze Nacht.